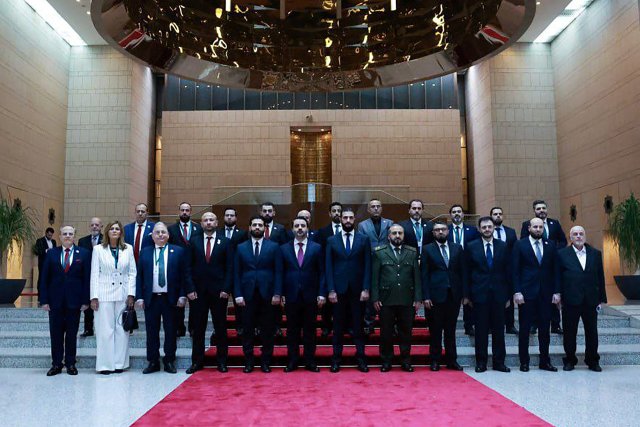- Politik
- Schutz von Atomanlagen
Drohnenschwärme: Die unterschätzte Gefahr für Atommülllager
Forschende sehen dringenden Handlungsbedarf

Vor einem Jahr wurden die letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet, ein Meilenstein, der viele Menschen erleichtert aufatmen ließ. Doch das Problem der Sicherheit von hochradioaktivem Atommüll wurde damit nicht gelöst. In 17 deutschen Zwischenlagern werden diese gefährlichen Abfälle aufbewahrt – ursprünglich als Übergangslösung für wenige Jahrzehnte gedacht. Doch die Suche nach einem tiefengeologisch geeigneten Endlager zieht sich weiter in die Länge, und manche dieser Zwischenlager könnten nun bis zu 50 Jahre bestehen. Während dieser Zeit wächst die Bedrohung nicht nur durch technische Mängel, sondern auch durch mögliche Angriffe, beispielsweise mit Drohnen oder sogar Schwärmen solcher unbemannten Systeme.
In den vergangenen Jahren häuften sich weltweit Berichte über Drohnenüberflüge an kritischen Infrastrukturen. Zwischen 2015 und 2019 wurden an 24 Nuklearstandorten rund 57 solcher Vorfälle gemeldet. Im Jahr 2022 sorgten Drohnen über dem schwedischen Atomkraftwerk Forsmark für Schlagzeilen, 2019 war das US-Kernkraftwerk Palo Verde Ziel unbekannter Drohnen, und in Frankreich wurden 2018 insgesamt mindestens 22 Überflüge verzeichnet. Diese Ereignisse verdeutlichen, dass viele Sicherheitskonzepte auf diese neue Art der Bedrohung nicht vorbereitet sind. Auch in Deutschland werden zunehmend Drohnen über sensiblen Standorten gesichtet, darunter Industriegebiete in Stade und Brunsbüttel. Besonders alarmierend ist dies angesichts der radioaktiven Abfälle, die dort lagern – in Brunsbüttel zudem ohne gültige Genehmigung in Castorbehältern. Seit Anfang August wurden an diesem Standort wiederholt nächtliche Überflüge unbekannter Drohnen gemeldet.
Allgegenwärtige Gefahr für kritische Infrastruktur
Versuche, diese Drohnen abzufangen, blieben bislang erfolglos. Die Flensburger Staatsanwaltschaft konnte trotz Nachfragen keine Details zu Herkunft, Typ oder möglichen Motiven der Überflüge nennen. Dabei macht die leichte Verfügbarkeit von Drohnen die Lage noch brisanter: Die rund 360 000 in Deutschland privat genutzten Drohnen (zumeist senkrecht startende Quadrokopter) könnten mit wenig Aufwand und durch Integration von Sprengstoff in Kamikazedrohnen umfunktioniert werden.
Kritiker wie Wolfgang Ehmke von der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg betonen, dass die bestehenden Schutzmaßnahmen etwa für Zwischenlager in Gorleben unzureichend sind. Selbst der aktuelle Bau einer zehn Meter hohen Mauer ist bestenfalls eine symbolische Maßnahme und kein wirksamer Schutz vor Angriffen aus der Luft. Ein gezielter Angriff durch sprengstoffbeladene Drohnen könnte auch an Standorten wie Ahaus katastrophale Auswirkungen haben. Dort bestehen wie in Gorleben teilweise nur 20 Zentimeter dicke Decken oder Wände, die weder einem koordinierten Angriff noch der Explosionskraft standhalten würden.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Es ist erstaunlich genug, dass bei den zuständigen Behörden in Deutschland erst nach den Angriffen vom 11. September 2001 in den USA die Frage nach der Sicherheit von Atomanlagen bei einem absichtlich herbeigeführten Flugzeugabsturz aufkam. 2013 wurde dazu nach einer Anwohnerklage die Betriebsgenehmigung des Standortzwischenlagers Brunsbüttel aufgehoben, da das Gericht »mehrere Ermittlungs- und Bewertungsdefizite hinsichtlich möglicher Auswirkungen eines gezielten Flugzeugabsturzes und eines Beschusses mit panzerbrechenden Waffen fest(stellte)«. So hat es die Physikerin Oda Becker vergangenes Jahr im Rahmen eines Berichts zu Gefahren von Atommülllagern ausgeführt. Für zentrale Zwischenlager wie Gorleben oder Ahaus bestehen aber nicht einmal Überflugverbote – trotz der immer offensichtlicheren Risiken, die von Drohnen ausgehen.
Unzureichende Schutzmaßnahmen für Zwischenlager
Drohnen – ob zu Wasser, in der Luft oder am Boden – wurden bereits im Vietnamkrieg eingesetzt. Heutzutage stehen sie im Zentrum moderner militärischer Strategien, was an ihrer (partiellen) Autonomie, ihrer präzisen Steuerung und datengestützten Vernetzung liegt. Besonders die sich beim Angriff selbst zerstörenden Kamikazedrohnen sind durch ihre Kosteneffizienz und flexible Einsatzmöglichkeiten zu einem »Game Changer« geworden, wie es der Einsatz im Ukraine- und Gaza-Krieg zeigt.
Ein Schwerpunkt der militärischen Forschung liegt auf autonomen Schwärmen solcher Drohnen. Ziel ist es, dass sie sich nicht nur flexibel an neue Situationen anpassen, sondern auch schwerer zu bekämpfen sind. Drohnenschwärme, die durch ihre schiere Anzahl an Geräten eine Strategie der »Brute Force« verfolgen, gelten zurzeit als größeres Problem als autonome Systeme.
2017 testete das US-Verteidigungsministerium über 100 3D gedruckte Kampfdrohnen mit dem Namen »Perdix«, die in Formation fliegen, Schwarmverhalten zeigen und selbstständig Entscheidungen treffen sollten. William Roper, Direktor des Amtes für strategische Einsatzmöglichkeiten, beschrieb die Vision so: »›Perdix‹ sind keine vorprogrammierten, synchronisierten Individuen, sie sind ein kollektiver Organismus mit einem geteilten Gehirn zur Entscheidungsfindung, das sich anpasst wie Schwärme in der Natur.« Tatsächlich ist die Verwirklichung dieser Vision noch weit entfernt. Es gibt im Moment noch keine autonomen, adaptiven und lernenden Drohnenschwärme, auch wenn das Militär bestrebt ist, diese Technologie weiterzuentwickeln.
Absturzfolgen könnten fatal sein
Zivile Drohnen können in Atomanlagen und Zwischenlagern unzugängliche Bereiche ausspionieren. Sie ermöglichen Angreifern Einblicke in Sicherheitsmaßnahmen, den Tagesablauf des Personals oder die baulichen Strukturen. Gefängnisse liefern ein warnendes Beispiel: Dort gelingt es Drohnen immer wieder, illegale Gegenstände über Sicherheitsmauern zu schleusen. Wenn solche Hochsicherheitsbereiche nicht ausreichend geschützt sind, zeigt dies, wie groß die Herausforderung bei der Sicherung von Atomanlagen ist.
Zusätzlich birgt die steigende Nutzung von Drohnen die Gefahr von Unfällen. Technisches oder menschliches Versagen, gestörte Funksignale oder gezielte Manipulation durch Dritte könnten Drohnen zum Absturz bringen. Die Folgen eines solchen Absturzes über einem Atommüllzwischenlager könnten fatal sein, vor allem, wenn außer Sprengstoff chemische oder biologische Kampfstoffe im Spiel sind.
Die konkreten Folgen solcher Angriffe für die Sicherheit der Lager oder die Castor-Transportbehälter für Atommüll bleiben unklar. Doch die unzureichenden Abwehrmaßnahmen lassen die Gefahren umso bedrohlicher erscheinen. Angesichts dieser Risiken wird deutlich, wie dringend effektive Maßnahmen für die Luftabwehr notwendig sind.
Krieg, Atomanlagen und Völkerrecht
Während in den 2000er und 2010er Jahren die Sorge vor terroristischen Flugzeugabstürzen dominierte, lenkt der Russland-Ukraine-Krieg die Aufmerksamkeit verstärkt auf die Risiken militärischer Konflikte für Atomanlagen. Die prekäre Situation des nunmehr von Russland kontrollierten ukrainischen AKWs Saporischschja zeigt, wie real diese Bedrohung ist. Allerdings ist dies keineswegs ein neues Problem: Bereits 1980 griff der Iran die irakischen Reaktoren Tammuz 1 und 2 an. Ein Jahr später zerstörte ein israelischer Bombenangriff Teile des inaktiven Reaktors Tammuz 1, wobei laut der Internationalen Atomenergieorganisation auch radioaktive Quellen beschädigt wurden. Schon damals warnte der Generaldirektor der Organisation vor weiteren katastrophalen Folgen militärischer Angriffe auf nukleare Anlagen. Im Golfkrieg 1991 zerstörten die USA unter Präsident George H. W. Bush dieselben irakischen Reaktoren dann vollständig.
Auch Europa ist nicht vor solchen Gefahren gefeit. Ein Beispiel ist das slowenische AKW Krško, das während des Unabhängigkeitskrieges 1991 vorsorglich abgeschaltet wurde, um es vor einem möglichen Angriff mit Luft-Boden-Raketen zu schützen. Besonders gefährlich wäre ein solcher Angriff für das ungeschützte Abklingbecken in der Nähe des AKWs gewesen. In jüngerer Zeit verdeutlicht indes der Iran die Brisanz militärischer Drohnen: 2021 drohte das Land, im Falle eines israelischen Angriffs die mit neusten KI-basierten Leit- und Kontrollanlagen ausgestattete Atomanlage Dimona in Israel mit Drohnenschwärmen und Marschflugkörpern anzugreifen. Dass selbst hochmoderne Patriot-Luftabwehrsysteme von tieffliegenden Kamikazedrohnen getäuscht werden können, zeigte bereits 2019 ein Angriff der Huthi-Rebellen auf eine saudi-arabische Ölraffinerie.
Steigende Bedrohung durch militärische Konflikte
Drohnen stellen bereits in Friedenszeiten eine erhebliche Gefahr für Atommüllzwischenlager dar. In militärischen Konflikten verschärft sich diese Bedrohung jedoch drastisch, insbesondere da Regularien unzureichend sind. Die Rüstungsforscherin Maria Kurando betont, dass solche Risiken bislang weder für Atomkraftwerke noch für Zwischenlager angemessen berücksichtigt wurden. Viele Anlagen sind schlicht nicht darauf ausgelegt, militärischen Angriffen standzuhalten. Die Annahme, dass ein solches Szenario nicht vorstellbar sei, entlarvt Kurando als Mythos – gerade angesichts der Geschichte militärischer Angriffe auf Atomanlagen.
Eine zentrale Ursache für die unzureichenden Schutzmaßnahmen liegt vermutlich in Kosten-Nutzen-Kalkulationen, bei denen der Schutz vor nuklearen Katastrophen zugunsten kommerzieller Interessen oft vernachlässigt wurde. Die Zahlen sind alarmierend: Nach der Abschaltung des letzten deutschen AKWs im April 2023 verbleiben beispielsweise 1900 Behälter mit hochradioaktivem Müll, was rund 27 000 Kubikmetern entspricht. Bis 2060 wird die Menge an schwach- bis mittelradioaktivem Abfall von derzeit 130 000 Kubikmetern (Stand Ende 2022) auf 300 000 Kubikmeter steigen. Allein aus abgebrannten Brennelementen werden bis 2080 zusätzlich 10 500 Tonnen hochradioaktive Abfälle erwartet. Diese Dimensionen machen deutlich, wie dringend ein sicherer, langfristiger Plan für die Lagerung dieser Abfälle notwendig ist.
Worst-Case-Szenarien müssen öffentlich diskutiert werden
Angesichts dieser wachsenden Bedrohung arbeiten Expert*innen an neuen Sicherheitskonzepten und internationalen Abkommen. Die Forscherin Kurando verweist auf den Pelindaba-Vertrag von 1996, der die Stationierung und Herstellung von Kernwaffen in Afrika untersagt. Auch das Abkommen zwischen Indien und Pakistan, das Angriffe auf kerntechnische Anlagen verbietet und eine Liste geschützter Anlagen umfasst, könnte als Modell für neue internationale Regelungen dienen.
Derartige Vorschläge sind dringend notwendig, da bestehende Regelwerke wie Artikel 56 des Zusatzprotokolls I der Genfer Konventionen lückenhaft und interpretationsfähig sind. Insbesondere der Schutz von Kühlbecken mit abgebrannten Brennelementen oder Atommüllzwischenlagern wird derzeit nicht ausreichend berücksichtigt. Die unklare Auslegung solcher Schutzvorschriften – etwa im Ukraine-Krieg – lässt zudem Raum für die Legitimierung militärischer Angriffe auf Nuklearanlagen. Durch eine mehr als flexible Auslegung könnte es möglich werden, dass eine kerntechnische Anlage zum legitimen militärischen Ziel wird.
Der Technikforscher Charles Perrow betonte bereits in den 80er Jahren in seiner Studie »Normale Katastrophen« zu den Risiken von AKWs, dass Risikoanalysen immer auch politische Entscheidungen verschleiern. »Letzten Endes geht es nicht um Risiken, sondern um Macht – um die Macht nämlich, im Interesse einiger weniger den vielen anderen enorme Risiken aufzubürden«, schrieb Perrow. Nach dem Unglück im Atomkraftwerk in Fukushima schob man den Grund für die Katastrophe – also für das Schmelzen von Reaktorkernen – auf eine mangelhafte Vorbereitung und Planung für den Ernstfall durch die zuständige Organisation. Man fragte aber nicht: Woher kommt das Versagen der Organisation? Wollte man Kosten sparen? Hat man bewusst weggeschaut? Denn in der Geschichte Japans gab es durchaus schon entsprechende Erdbeben und Tsunamis, und so hätte man wissen können, dass die Mauern um Fukushima nicht hoch genug waren. Und die Firma Tepco hatte kein Worst-Case-Szenario entworfen – womöglich, weil dessen Konsequenzen zu einer nicht gewollten Kostenexplosion geführt hätte.
Daraus kann man lernen: Wir sollten Worst-Case-Szenarios für die Atommülllager in Krieg und Frieden entwickeln und vor allem dieses Problem öffentlich diskutieren. Spätestens, wenn Atommülllager ohne Genehmigung einfach weiter betrieben werden, wird deutlich, dass man auf die Behörden nicht vertrauen kann. Nur durch Transparenz, öffentliche Debatten und ein Umdenken in der Risikoanalyse kann ein sicherer Umgang mit den nuklearen Hinterlassenschaften gewährleistet werden.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.