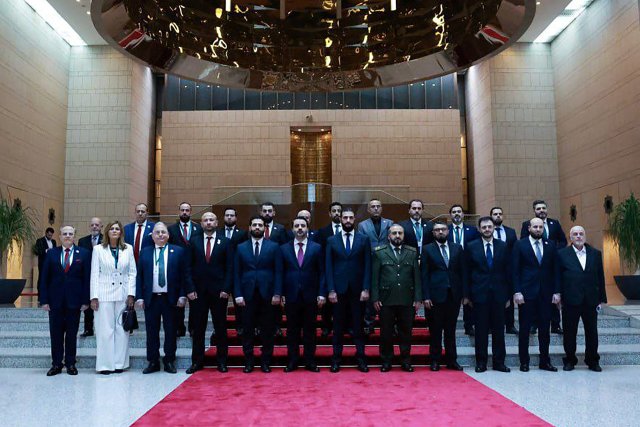- Politik
- Kuba-Politik der USA
»Politik des maximalen Drucks«
Mit einem potenziellen Außenminister Marco Rubio ist eine noch aggressivere Kuba-Politik der USA zu erwarten

»Es sind weit zurückliegende Zeiten«, sagt Martín Hacthoun. Er ist Redakteur bei der kubanischen Nachrichtenagentur »Prensa Latina«. »Auch unter Obama gab es keine engen Beziehungen zu den USA, aber es gab eine Annäherung und eine bessere Verständigung«, sagt er mit Blick auf die letzten Jahre der seit 2009 währenden Obama Amtszeit von 2014 bis 2017. Die Aggressivität der USA gegenüber Kuba, die er Anfang der 90er Jahre ganz nah als Korrespondent bei den Vereinten Nationen in New York erlebt hatte, sei in jenen Jahren zurückgegangen. »Im Rückblick waren es glücklichere Zeiten, die sich in der kubanischen Wirtschaft widergespiegelt haben.« Es gab einen leichten wirtschaftlichen Aufschwung, die Versorgungslage verbesserte sich. »Nicht so sehr die USA selbst, aber Drittstaaten nutzten das Tauwetter, um mit Kuba Handel zu treiben, der Tourismus florierte, Kreuzfahrtschiffe legten im Hafen von Havanna an. All das generierte mehr Einnahmen. Wirtschaftlich ging es uns besser«, sagt Hacthoun.
Doch dann kam 2017 Donald Trump und ersetzte Obamas Annäherung durch eine »Politik des maximalen Drucks«. Die von Trump verhängten Sanktionen gegen Kuba sind die härtesten seit Präsident John F. Kennedy (1961-63). Er schränkte die Reisen US-amerikanischer Bürger nach Kuba ein, setzte mehr kubanische Unternehmen auf eine schwarze Liste, mit denen US-Amerikaner keine Geschäftsbeziehungen unterhalten dürfen, reduzierte das US-amerikanische Botschaftspersonal in Havanna wegen angeblicher »Schallattacken« und aktivierte ein Gesetz, das Schadensersatzklagen vor US-Gerichten gegen Unternehmen erlaubte, die nach der Revolution verstaatlichten Besitz in Kuba nutzen. Kurz vor Ende seiner Amtszeit stufte Trump das Land auch wieder als »Terror unterstützendes Land« ein. Das macht internationale Finanztransaktionen für Kuba nahezu unmöglich.
Entgegen anderslautender Ankündigungen im Wahlkampf kehrte Joe Biden als Präsident nie zu Obamas Tauwetter-Politik zurück. Im Gegenteil: Erst in der vergangenen Woche listete das US-Außenministerium Kuba neben Iran und Nordkorea erneut als »staatlichen Sponsor des Terrorismus«. »Biden hat die Sanktionen von Trump nahezu komplett in Kraft gelassen und auch die aggressive Rhetorik Trumps beibehalten«, zeigt sich Hacthoun enttäuscht. »Das hat die Menschen in Kuba entmutigt und desillusioniert.«
Die Verschärfung der US-Blockadepolitik, der Einbruch des wichtigen Devisenbringers Tourismus infolge der Pandemie sowie der Anstieg der Weltmarktpreise für Lebensmittel und Brennstoffe haben der importabhängigen kubanischen Wirtschaft schwer zugesetzt. Hinzu kommen eigene strukturpolitische Fehler. Die Währungsreform Anfang 2021 heizte die Inflation zusätzlich an und kostete die Regierung viel politisches Kapital. Kuba steckt in einer tiefen Wirtschafts-, Energie- und Versorgungskrise. Es mangelt dem Staat an Grundnahrungsmitteln, Medikamenten, Benzin. Mehr als eine Million Kubaner – zehn Prozent der Bevölkerung – haben der Insel in den vergangenen drei Jahren den Rücken gekehrt. Im einstmals vorbildlichen Gesundheits- und Bildungssystem fehlen heute Ärzte und Lehrkräfte. Seit Mitte Oktober ist das marode Stromnetz dreimal komplett zusammengebrochen – es fehlt an Brennstoff und Ersatzteilen für die in die Jahre gekommenen Heizkraftwerke sowjetischer Bauart. Zwei Hurrikane und ein Erdbeben haben Kuba zusätzlich belastet.
Und das nächste Unheil braut sich schon zusammen. Neuer US-Außenminister könnte Marco Rubio werden. Der republikanische Senator aus Florida, dessen Eltern Kuba noch vor Beginn der Revolution verlassen hatten, hat in Trumps erster Amtszeit dessen Sanktionspolitik maßgeblich mit angestoßen. Die Regierung in Havanna bezeichnete Rubio wiederholt als »kriminelles Regime«. Vieles deutet also auf eine noch aggressivere Kubapolitik Washingtons hin. »Die Obsession Rubios gegenüber Kuba ist mehr ideologisch-politisch als wirtschaftlich«, so Hacthoun. »Was können Trump und Rubio noch unternehmen?«, fragt er. »Sie können die Flüge streichen. Oder die Rücküberweisungen erschweren. Okay. Aber damit treffen sie kubanische Familien, denen die US-Regierung vorgibt, helfen zu wollen.«
Rubios Ernennung wäre ein Zeichen für eine verstärkte Aufmerksamkeit der USA für Lateinamerika, das lange Zeit nicht zu den Prioritäten gehörte. Es sei anzunehmen, dass Rubio alle Entspannungsschritte gegenüber Kuba seit der Clinton-Administration auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls zurücknehmen werde, meint John S. Kavulich, Präsident des in New York ansässigen US-Cuba Trade and Economic Council, in seinem Blog. »Das bedeutet für jeden, der sich auf Kuba konzentriert, den schlimmsten aller möglichen Albträume – und einen, der vier Jahre andauern könnte.« Andere Analysten glauben, dass vor allem Sanktionen gegen mit Kuba geschäftlich verbundene Einzelpersonen und Firmen zunehmen werden.
Heute gebe es zwischen beiden Ländern im Grunde keine wirklichen Beziehungen, sondern vor allem konflikthafte Verbindungen, sagt Hacthoun, auch wenn man in einigen Bereichen, wie der Drogenbekämpfung, zusammenarbeite. »Wir Kubaner sind darauf vorbereitet«, so Hacthoun mit Blick auf Trumps zweite Amtszeit und einen möglichen US-Außenminister Rubio. »Es wird mehr vom Gleichen sein.« Hacthoun glaubt, dass es mehr Versuche der USA geben werde, »die existierende Unzufriedenheit zu kapitalisieren, um einen Kontext zu schaffen, der einen Vorwand zur Rechtfertigung einer ›humanitären Intervention‹ bietet«. Die erwartet härtere Haltung Washingtons gegenüber Kuba dürfte die Krise auf der Insel verlängern und damit den Exodus weiter befeuern.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.