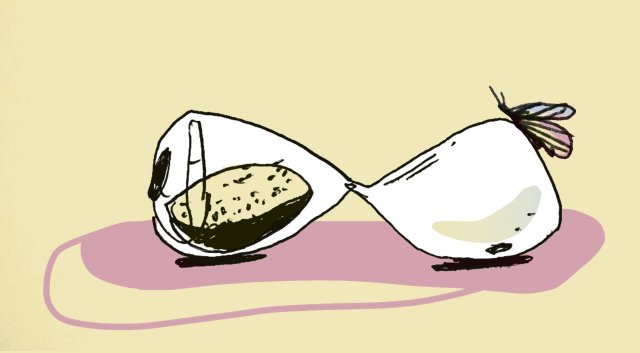- Politik
- Flucht und Asyl
Geflüchtete in der Warteschleife
Asylbewerber und Geduldete können über ihre Zeit nicht verfügen, keine Pläne machen. Viele dürfen weder arbeiten noch eine Ausbildung beginnen

Seit 2016 lebt Milad* in Deutschland. Im Oktober 2017, nachdem der Sturm Xavier über Berlin hinweggezogen war, kam ich erstmals mit ihm ins Gespräch. Vom Sehen kannten wir uns schon länger, denn auch er pendelte zwischen dem Dorf, in dem ich lebe, und Berlin. Und jetzt hofften wir im Bahnhof Lichtenberg auf einen Zug. Es kam keiner mehr, wir erwischten aber irgendwann ein Taxi und waren vor Mitternacht da draußen, in Brandenburg.
Heute ist Milad Anfang 40 und ein bisschen angekommen. Aber darauf musste er lange warten. Er flüchtete aus Afghanistan, weil sein Vater, der für die US-Armee gearbeitet hatte, von Taliban ermordet worden war. Er hoffte, seine Ehefrau und die beiden kleinen Kinder schnell nachholen zu können. Schließlich waren auch sie in Gefahr. Doch erst einmal wartete er acht Monate auf die Entscheidung über seinen Asylantrag, der irgendwann anerkannt wurde, und dann viele weitere auf die Genehmigung seines Gesuchs auf Familiennachzug.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Irgendwann traf ich ihn beim Einkaufen, und er strahlte. Er wohnte nicht mehr in der abgelegenen Geflüchtetenunterkunft zwischen zwei Dörfern, sondern hier in der Kreisstadt, in einer eigenen Wohnung zusammen mit seiner Familie. Und er hatte eine Arbeit in der Region. Mittlerweile gehen seine Kinder hier zur Schule. Sie haben tolle Zeugnisse, erzählt Milad stolz. In Jahren des Wartens war er täglich viele Stunden unterwegs, um in Berlin mies bezahlte Jobs zu verrichten, um seine Familie ein wenig zu unterstützen. Mit dem Rad brauchte er 20 Minuten zum Bahnhof, von dort noch mal zwei Stunden zur Arbeit.
Von den abgelegenen Heimen müssen die dort Lebenden nicht nur zur Arbeit gelangen, wenn sie eine haben, sondern auch zur Ausländerbehörde. Denn sie mussten sich dort in meinem Landkreis schon immer jeden Monat persönlich ihre Sozialleistungen abholen, viele Jahre als Scheck. Seit April dieses Jahres gibt es die Bezahlkarte, aber auch die wird nur bei persönlichem Erscheinen aufgeladen. Die Behörde befindet sich aber nicht in der Kreisstadt, sondern mehrere Kilometer außerhalb.
Dieses Warten nach dem Ziehen einer Nummer und das Hoffen auf eine vage Chance, bleiben zu dürfen, kennen wohl alle, die jeden Monat aufs Amt müssen. Zusätzlich haben viele von ihnen alle drei Monate zu erscheinen, um ihr Duldungspapier verlängern zu lassen.
Auch Aslan* ist einer von ihnen, obwohl er, anders als die meisten hier, perfekt Deutsch spricht. Er war zwölf, als er mit der Mutter und seinen Geschwistern aus Tschetschenien nach Deutschland kam. Mittlerweile ist er 20. Dabei hat er als Kind immer wieder gehört, sie würden bald abgeschoben. Er musste solche Auskünfte für seine Mutter übersetzen. Bis heute kostet ihn auch deshalb jeder Behördengang viel Kraft. Er habe früh gelernt, »gefühllos zu leben«, sagt er. Es sei schließlich von Nachteil gewesen, Angst, Trauer oder gar Wut nach draußen zu lassen. Immerhin: Das Jugendamt kümmerte sich um ihn, als er wegen in der Familie erlebter Gewalt von dort weg wollte. Und zur Abschiebung kam es dann doch nicht. Er kam wegen zunächst fehlender Deutschkenntnisse erst einmal in eine Grundschule, wechselte dann aufs Gymnasium. Nach dem Abitur wollte er soziale Arbeit studieren.
Doch dann der Schock: Er war gerade 18 geworden und besuchte die zehnte Klasse, und plötzlich erhielt er ein Schreiben mit einer Ausreiseaufforderung sowie einer Grenzübertrittsbescheinigung. Dabei hätte er als »gut integrierter Jugendlicher« alle Kriterien für die Erteilung einer eigenständigen Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 25a des Aufenthaltsgesetzes erfüllt.
Stattdessen drohte ihm nun also wieder die Abschiebung. Er versteckte sich wochenlang bei Freunden und Bekannten. Später stellte er mit Hilfe von Betreuern und Unterstützern einen Antrag auf Gewährung der Aufenthaltserlaubnis. Die wurde ihm in Aussicht gestellt, hatte aber eine Vorbedingung: Er brauchte einen gültigen Pass. Seiner war abgelaufen.
Doch mit der russischen Invasion der Ukraine erhöhten sich die bürokratischen Hürden zur Passerlangung drastisch. Termine können nur noch online gebucht werden. Man bekommt aber keinen, sondern landet in der virtuellen Warteschlange. Ins Konsulat wird man nicht gelassen. Zwar liegt den deutschen Behörden die Geburtsurkunde von Aslan vor, seine Identität ist also geklärt. Eine Arbeit oder Ausbildung darf er trotzdem erst aufnehmen, wenn er wieder einen gültigen Pass hat.
Das Chancenaufenthaltsrecht, das auch Personen ohne Pass für maximal 18 Monate gewährt werden kann, gibt es für ihn nicht. Denn seit er vergangenes Jahr seine Papiere verlor und sich danach längere Zeit nicht zum Amt traute, gilt er nicht mehr als »gut integriert«. Einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis nach Paragraf 25a kann er deshalb frühestens in drei Jahren wieder stellen. Und so wartet er weiter auf seinen Termin, schaut Politsendungen und streamt Serien. Verbessern sich die deutsch-russischen Beziehungen eines Tages wieder, steigen seine Chancen auf einen Pass. Zugleich wächst dann die Gefahr der Abschiebung.
*Name geändert
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.