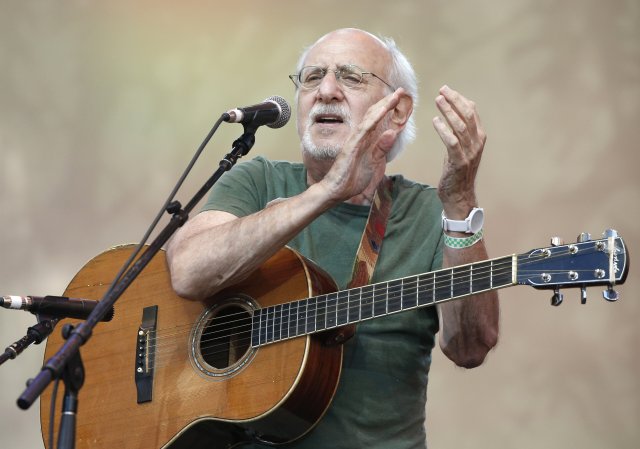- Kultur
- Foucault im Radio
Schatz im Sprachmeer
Seine gesammelten Radio-Features präsentieren einen anderen, poetischen Michel Foucault

Seit Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau ist jeder große politische Denker befehdet worden. Es überrascht deshalb nicht, dass der vor 40 Jahren verstorbene Michel Foucault zum Buhmann rechter Kulturkämpfer und linker Bürgerinnen geworden ist. Überraschend ist lediglich, dass sich das, was ihm zur Last gelegt wird, gar nicht in seinen Schriften findet.
Man nehme nur die von Susan Neiman oder Nathalie Heinich gegen ihn erhobenen Vorwürfe, er sei der geistige Vater der Identitätspolitik. Das ist schon deshalb absurd, weil die »Identität« von kaum einer anderen Theorie so fundamental infrage gestellt wird wie von der seinen. Sicher, er war ein Aktivist in der Anti-Knast-Bewegung und holte sich in Schlachten mit der Polizei eine blutige Nase. Auch steht sein Name für die Ziele der Antipsychiatrie. Fredric Jameson stellt zu Recht fest, Foucault sei nicht der Theoretiker der Macht, sondern der Haft. Aber dass er gegen Asyle, Zuchthäuser und kalte Duschen eintrat, heißt noch nicht, dass er an die Identität oder gar Idealität irgendeiner verfolgten Minderheit geglaubt hätte. Im Gegenteil, gerade dass die Wahnsinnigen, die Perversen, die »Infamen« aus diesem und jenem Grund keine Identität erlangen können, wollen oder dürfen, macht ihn neugierig.
Auch das von Jubelpersern ausgestreute Gerücht, er wäre am Ende seines Lebens Islamist geworden, ist haltlos. Wer die Reportagen liest, die Foucault 1978 aus dem Iran an den »Corriere della Sera« schickte, wird Freude über den Untergang der Despotie des Schahs, auch eine Bereitschaft, sich mit den neuen Herrschern ins Benehmen zu setzen, aber vor allem viel vorsichtige Distanz entdecken. Da heißt es, als Westler möge man sich mit Urteilen vorerst zurückhalten, da heißt es auch, er selbst verstehe noch sehr wenig vom Iran. Und da heißt es, er halte, was gerade geschieht, nicht für eine »Revolution«. »Das ist vielleicht der erste große Aufstand gegen die Systeme des Planeten, die modernste und die verrückteste Form der Revolte.«

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Darüber, dass es vielleicht eine moderne, aber keine modernistische Revolte war, sind wir inzwischen belehrt. Aber dass es in seinen Augen auch eine »verrückte« gewesen ist, erklärt, was Foucault am Iran faszinierte. Seine gerade in einer Transkription erschienenen Radiosendungen beleuchten diesen Punkt besonders gut. Interviews und Diskussionen begleiten die Veröffentlichung seiner Bücher von 1961 bis etwa 1976. Die wenigen Auftritte, die er danach noch im Hörfunk absolviert, fallen nicht mehr ins Gewicht. Da es nur am Rande um »Die Ordnung der Dinge« (1966) oder »Die Archäologie des Wissens« (1969) geht, stehen die Geschichte und die Literatur des Wahnsinns im Zentrum, also sein erstes Hauptwerk, »Wahnsinn und Gesellschaft« (1961), und alles, was es flankiert hat, etwa seine Einlassungen zu dem Schriftsteller Raymond Roussel oder zum Marquis de Sade.
Noch weit interessanter als das, was er Journalisten oder bei Debatten mit Louis Althusser oder Pierre Klossowski sagt, sind seine Feature-Serien über die »Sprachen des Wahns«, über »Schmerz und Leiden« oder über »Rousseau, Richter von Jean-Jacques« (1776), eine zu Unrecht ignorierte Spätschrift Rousseaus. In seinen Funk-Essays, die in den frühen 1960ern entstanden, schlägt Foucault einen ungewöhnlich persönlichen, ja poetischen Ton an.
Die Verrückten wurden erst gefeiert, dann weggesperrt, schließlich für krank erklärt und »geheilt«. Während er in seinen Büchern herausarbeitet, wie es dazu kam, dass im Zeitalter des Merkantilismus, also ab dem 17. Jahrhundert, die Unvernünftigen, ja überhaupt alle als asozial geltenden Gestalten, die Schwulen, die promisken Frauen oder die Tagträumer, in Arbeitshäuser gesteckt wurden, richtet er sein Augenmerk in den Features auf das ausgehende Mittelalter. Der Narr, nicht allein der Hofnarr, hat damals die Aufgabe, der Gesellschaft die Wahrheit ins Gesicht zu schleudern. Davon zeugt das in Nordeuropa am 1. Januar abgehaltene Narrenfest und sein »Deposuit potentes«, also der imaginierte Sturz der Mächtigen von ihrem Thron.
Foucault erlebt diesen rebellischen Geist noch 1954 bei einem Fest in der Psychiatrie von Münsterlingen (Schweiz). Spuren findet er aber auch in Gedichten und Erzählungen. Dabei zieht er keineswegs nur die einschlägigen Verrückten wie Antonin Artaud oder August Strindberg heran. Sogar bei so harmlosen Romanciers wie Guy de Maupassant oder Thomas Mann (»Der Erwählte«, 1951) wird er fündig. Dabei erscheint der Irrsinn als die Rückseite der sinnvollen Rede. Über Friedrich Nietzsche heißt es, er sei, lange bevor er es wurde, das Risiko eingegangen, verrückt zu werden. »Jedem Menschen, der spricht, steht zumindest insgeheim die Freiheit offen, verrückt zu werden. Umgekehrt bleibt jeder Mensch, der verrückt und so der Sprache der Menschen fremd geworden ist, ein Gefangener des geschlossenen Universums der Sprache.«
Auch hier gilt wieder: Foucault sucht nicht jenseits der bürgerlichen Identität eine Gegen-Identität, sondern ermittelt die Bedingungen jeglicher Identitätsbildung. Er will Vernunft historisch und dialektisch denken und alles von ihr Ausgeschlossene, auch das Absonderliche, Gewaltsame und Triebhafte, bergen. »Ohne Nacht erschiene uns der Tag sehr blass.« Auffällig ist, dass er, anders als Julia Kristeva, den Widerpart der Vernunft nicht auf der gestisch-körperlichen – oder, wie sie es nennt, »semiotischen« –, sondern auf der semantisch-inhaltlichen Ebene der Sprache vermutet. Er geht beispielsweise Rousseaus fixer Idee, er werde verfolgt, so ernsthaft nach, als stünde der Begriff des Verfolgtseins selbst auf dem Spiel. »Es ist nicht wahr, dass sich die Sprache der Dinge bemächtigte, um sie zu übersetzen, vielmehr ruhen sie in ihr wie ein stummer, versunkener Schatz mitten im Tosen des Meeres.«
Michel Foucault: Entretiens radiophoniques 1961–1983. Hg. v. Henri-Paul Fruchaud. Flammarion, Paris 2024, 933 S., br., ca. 58 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.