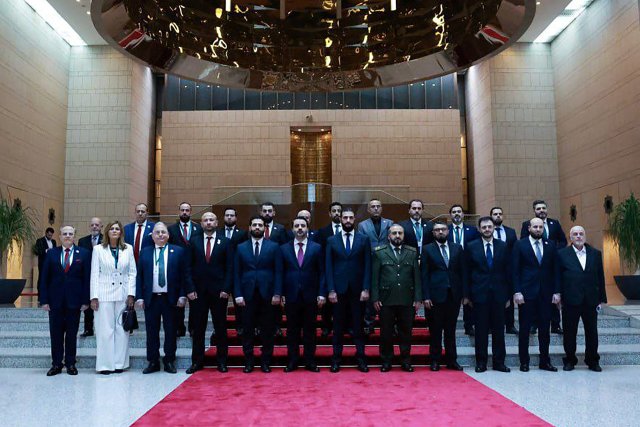- Politik
- Geschichte der Klassenkämpfe
Rotes Signal aus dem Norden
1957 begannen die Metallarbeiter Schleswig-Holsteins den Kampf für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Nun steht diese (wieder) zur Debatte

Im Herbst des Jahres 1956 richteten sich die Blicke in der Bundesrepublik nach Schleswig-Holstein. Im nördlichsten Bundesland traten die Metallarbeiter in den Streik – und dieser sollte zum längsten Arbeitskampf in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Seit fast einem Jahr waren die Beschäftigten ohne gültigen Tarifvertrag geblieben und die insgesamt zehn Verhandlungsrunden mit den Bossen mussten Ende September ohne Ergebnis endgültig abgebrochen werden. Fast 78 Prozent der Mitglieder der IG Metall sprachen sich im Anschluss für den Ausstand aus.
Am 24. Oktober war es dann so weit: Ausgehend von den gut organisierten Belegschaften in den Werften und Maschinenfabriken in und um die Landeshauptstadt Kiel breitete sich die Streikfront wie ein Lauffeuer zwischen Flensburg und Lübeck aus. Bis Mitte Februar des folgenden Jahres sollte sich der Arbeitskampf hinziehen, auf dem Höhepunkt im Januar befanden sich über 34 000 Kollegen im Streik. Während es in Schleswig-Holstein in den über sieben Jahren zwischen der Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949 und dem Herbst 1956 lediglich 1 110 000 Streiktage gegeben hatte, fielen allein in dem großen Metallarbeiterstreik 1956/57 2 230 000 Tage an.
Wirklich solidarischer Arbeitskampf
Bis heute hat dieser verbissen geführte Streik seine Bedeutung für die Beziehung zwischen Kapital und Arbeit in der Bundesrepublik nicht verloren. Denn es ging um Prinzipielles: Stellvertretend für die Arbeiter*innen im ganzen Land kämpften die Metaller des Nordens vor allem für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die den Arbeiter*innen – anders als den Angestellten – nach wie vor vorenthalten wurde. »Der Streik hatte eine hohe Beachtung gefunden, nicht nur bei der IG Metall«, erinnerte sich der am Streik beteiligte Udo Ehmcke in dem 2024 vom »NDR« produzierten Dokudrama »Die Mutigen – Deutschlands längster Streik« später. Und je länger er gedauert habe, »desto mehr Hoffnung setzten die Gewerkschafter da rein«, so der Metallarbeiter aus Bargteheide.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Vor diesem Hintergrund überraschte auch die Solidarität nicht, die den Streikenden entgegenschlug. Überall im Land sammelten Ortsgruppen verschiedener Gewerkschaften Streikgelder – jede Woche wurden zwei Millionen D-Mark ausgezahlt –, allein aus Mannheim verschickte die Ortsgruppe der IG Metall 3000 Päckchen mit Lebensmitteln an die Familien der Kollegen im Norden, der DGB versendete üppig ausgestattete Weihnachtspäckchen an alle Streikenden und selbst aus Dänemark und den USA kam finanzielle Unterstützung, um das »Wirtschaftswunder in Deutschland« zu einem »Wirtschaftswunder für die Arbeiter« zu machen, wie es in einem Grußtelegramm der US-Stahlarbeitergewerkschaft hieß.
Klassenkampf auch von oben
Aber auch die Gegenseite erkannte die Bedeutung des Kampfes. Als »Todesstoß für die deutsche Wirtschaft« bezeichnete etwa der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) die Lohnfortzahlungsforderungen in einer Presseerklärung zum Streik, und der Chef der bestreikten Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) in Kiel, Adolph Westphal, beschimpfte die Belegschaft in den »Kieler Nachrichten« öffentlich als »Proleten«, die »die Hand beißen, die sie füttert«. Ganz im Ton der Zeit denunzierte schließlich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Kai-Uwe von Hassel (CDU) die Streikenden als »Drückeberger«. Wenig überraschend stellten sich auch die meisten Zeitungen gegen den Arbeitskampf. »Vor den Toren herrscht Terror«, titelte etwa die »Bild«-Zeitung. Vor allem der kommunistische Betriebsrat und Vertrauensmann auf der Howaldtswerft, Hein Wade, diente im antikommunistischen Klima der 50er Jahre den norddeutschen Regionalzeitungen als Projektionsfläche, um die Streikenden zu isolieren.
Dass gerade auch konservative Kreise die Auseinandersetzung als sehr bedeutsam wahrnahmen, wurde ersichtlich, als sich sowohl Bundeskanzler Konrad Adenauer als auch Nordrhein-Westfalens ehemaliger Arbeitsminister, Johann Ernst, im Januar 1957 als Schlichter empfahlen: Mit dem Angebot von deutlicheren tariflichen Verbesserungen versuchten die beiden CDU-Politiker, die Forderungen nach Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall doch noch zu verhindern. Die mit jeweils deutlichen Mehrheiten der Stimmen der IG-Metall-Mitglieder erfolgten Zurückweisungen der Schlichtersprüche stellten allerdings klar, dass sich die Streikenden ohne eine grundlegende Anerkennung gerade dieser Forderung nicht zufriedengeben würden.
Alle Beschäftigten in der DDR genossen eine weitgehend unbeschränkte Fortzahlung der vollen Löhne bei Krankheit.
Am Ende kam es aber, wie es kommen musste: Um den »Risiken eines ausgedehnten Streiks mit politischen Konsequenzen« aus dem Weg zu gehen, willigte die Tarifkommission der IG Metall schließlich doch in einen leicht veränderten Schlichterspruch ein, der zwar keine wirkliche Lohnfortzahlung beinhaltete, aber immerhin deutliche Verbesserungen brachte. Bis dahin hatte im Krankheitsfalle von Arbeiter*innen gegolten, dass ihnen nach drei unbezahlten Karenztagen Haus- und Krankengeld durch die Sozialversicherungen gezahlt wurde, was in der Summe etwa der Hälfte des Nettolohns entsprach. Diese Ansprüche wurden nun deutlich erhöht: Auf 90 Prozent des Verdienstes sollten die Unternehmen diese Gelder fortan laut tariflicher Vereinbarung aufstocken. Allerdings blieb die Regelung dreier unbezahlter Karenztage weiterhin in Kraft, was insbesondere bei kürzeren Krankheitszeiten zu immensen Lohnverlusten führte.
Von einer Regelung, wie sie für die Angestellten galt, die volle sechs Wochen ihre gesamten Bezüge weiterhin erhielten, blieben die Arbeiter*innen in der Bundesrepublik so weiterhin ausgeschlossen. Wie unzufrieden die meisten der Streikenden mit diesem Ergebnis waren, wurde deutlich, als sich am 13. Februar fast 60 Prozent von ihnen gegen diesen Abschluss aussprachen – zu wenige allerdings, um die ausgesprochen undemokratische Hürde von 75 Prozent der Stimmen für eine Weiterführung des Arbeitskampfes zu erreichen, die in der Bundesrepublik bis heute gilt. Und so endete der längste Streik der bundesrepublikanischen Geschichte ohne großen Sieg.
Systemkonkurrenz um Sozialpolitik
Klar geworden war aber, dass die westdeutschen Arbeiter*innen nicht länger bereit sein würden, sich »als Menschen zweiter Klasse behandeln zu lassen«, wie der spätere sozialdemokratische Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller bilanzierte. Hinzu kam die Frontstellung im Kalten Krieg, genossen doch alle Beschäftigten in der DDR eine weitgehend unbeschränkte Fortzahlung der vollen Löhne bei Krankheit. War die SPD 1955 noch mit einem Gesetz zur Gleichstellung von Angestellten und Arbeiter*innen im Bundestag an der konservativ-liberalen Mehrheit gescheitert, so waren nun auch Teile der CDU aufgrund des gesellschaftlichen Drucks bereit, Reformen in Angriff zu nehmen. Nur wenige Monate nach Beendigung des Streiks in Schleswig-Holstein, am 26. Juni 1957, verabschiedete der Bundestag schließlich das »Gesetz zur Verbesserung der wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfall«, das sich an den dort erkämpften Ergebnissen orientierte.
Die Bosse liefen dagegen weiterhin Sturm – 1962 etwa begannen der BDI und der Bundesverband der Arbeitgeberverbände (BDA) eine Anzeigen-Kampagne gegen die »Verlagerung der Kosten auf die Unternehmen«, die »mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten im Augenblick nicht vereinbar« sei. Trotzdem war es nur noch ein kleiner Schritt hin zur Einführung einer wirklichen Lohnfortzahlung, wie sie schließlich nach dem Wahlsieg der sozial-liberalen Koalition am 1. Januar 1970 mit dem »Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall« in Kraft trat. Nun mussten die Unternehmen für sechs Wochen die vollen Löhne an alle Beschäftigten weiterzahlen.
Sie lassen nicht locker
Einmal schon aber geriet diese sozialstaatliche Errungenschaft in ernsthafte Gefahr: Angefeuert von BDI und BDA legte die Regierung Helmut Kohls im Jahr 1996 ein »Programm für mehr Wachstum und Beschäftigung« vor, in dem die »Reduzierung des Krankenstands und die Entlastung der Unternehmen« eine zentrale Rolle einnahmen. Das Ergebnis war das Entgeltfortzahlungsgesetz vom Oktober 1996, nach dem die Lohnfortzahlung bei Krankheit auf 80 Prozent reduziert wurde. Spuren hinterließ diese Kürzung aber zum Glück kaum. Das lag zunächst daran, dass die Gewerkschaften im »heißen Herbst« jenes Jahres dafür sorgen konnten, dass in fast alle Tarifverträge doch wieder die volle Lohnfortzahlung eingeschrieben wurde. Zudem waren die Tage Kohls als Kanzler zu dem Zeitpunkt schon gezählt. Nur zweieinhalb Jahre später revidierte die rot-grüne Bundestags-Mehrheit das Gesetz.
In den vergangenen Wochen rief nun der Allianz-Chef Oliver Bäte laut nach einer Wiedereinführung von Karenztagen, was auf Begeisterung etwa in der FDP und bei Industriellen wie dem Vorstandsvorsitzenden von Mercedes, Ola Källenius, stieß. Und unter einer von Friedrich Merz (CDU) geführten Bundesregierung würde dieser Ruf in jedem Fall noch stärker werden. Wieder wird es auf die mit Verbissenheit geführten Kämpfen der Lohnabhängigen ankommen, ob diese ihre sozialen Rechte werden verteidigen können. Die Metallarbeiter im Schleswig-Holstein der 50er Jahre haben ihnen dabei immerhin den Weg gewiesen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.