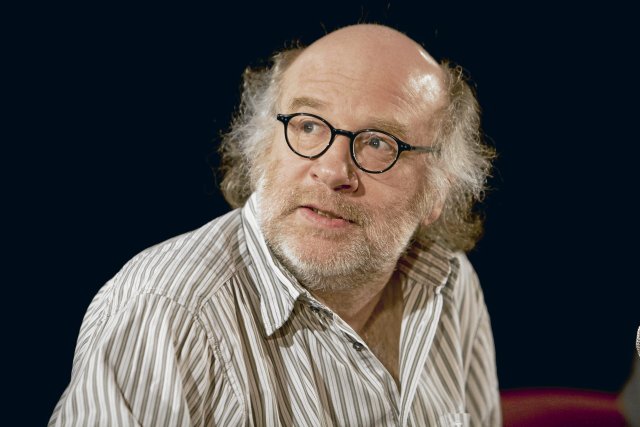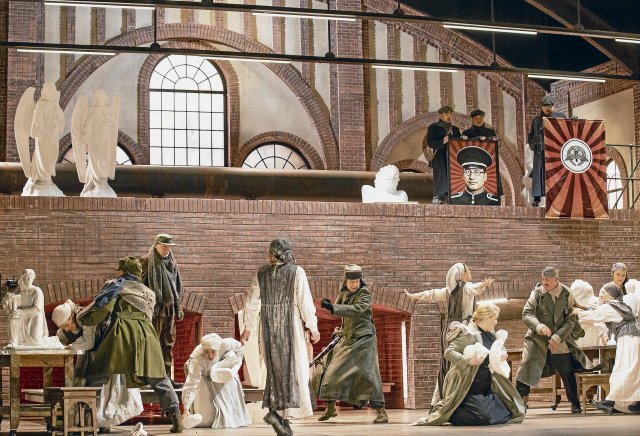- Kultur
- Reportage - Buchhagen
Deutsch für Orthodoxe
Auf einem Nordosthang des Voglergebirges im Weserbergland bei Hameln erhebt sich oberhalb von Buchhagen eine bemerkenswerte Klosteranlage: Stammsitz für die erste deutsche orthodoxe Mönchsgemeinschaft.
Achteckige Spitztürmchen bewehren die übermannshohe Mauer, die der Wald am Ende eines steilen, steinigen Weges freigibt. Den einzigen Durchlass bildet eine schwere Holzpforte, die eine Abendmahl-Ikone bekrönt. Das Portal öffnet sich überraschend leicht. Auch der Blick in den Innenhof erhascht ein unerwartet farbiges Bild. Acht Säulen mit griechischen Kapitellen aus rötlichem Sandstein umfassen einen Weihwasserbrunnen. Offenbar sind sie noch im Bau, denn Rundbögen und Kuppel fehlen.
Ein Schild bittet den geschätzten Gast, sich vor Eintreten seiner Schuhe zu entledigen. Der Gast tut es gern, er drückt die Klinke nieder, schiebt die Tür auf – und weicht respektvoll zurück. Er blickt in eine Krypta, eine Säulengruft wie aus einer anderen Welt. Steinerne Wände, steinerne Böden, steinerne Decken, geziert von Leuchtern, liturgischen Gefäßen, Ikonen und Pulten mit heiligen Schriften umfangen ihn – und machen ihn zugleich befangen. Er schaut auf Männer, die gerade ihrem Gebet nachgehen. Sie tragen lange schwarze Chormäntel und darüber kapuzenähnliche Überwürfe.
Gottes Urgesetz: Wie im Himmel, so auch auf Erden
Das Alter der Männer ist daher schwer zu schätzen, ihre Agilität beeindruckt indes. Denn während sie unentwegt und scheinbar ohne Luft zu holen ausrufen: »Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner«, werfen sie sich in ganzer Manneslänge häufig kurz auf den kalten Boden, um sogleich wieder aufzustehen, sich mit großer Geste zu bekreuzigen und in einem kleinen Kreis weiter zu laufen. Wieder und wieder. Unversehens glaubt sich der Besucher in ein byzantinisches oder altgriechisches Bethaus versetzt.
Schließlich gibt ein Mönch mit einem fast weißen Bart ein Zeichen: Das Zeremoniell geht zu Ende. Die anderen verneigen sich vor ihm und verlassen die Krypta. Oder genauer den Narthex. So erläutert es Vater Johannes, als der er sich nun vorstellt, in entspanntem, freundlichem Deutsch. »Es ist der erste Raum nach der ersten Schwelle – der Vortempel.« Seine Augen blicken gütig zwischen Kapuze und Bart hindurch: »Wir sind im Raum des Gesetzes, des christlichen Ethos, in dem man sich im Stand des Lernens befindet. Denn hier«, er macht eine Pause, die auf Bedeutsames hinweist, »gilt Gottes Gesetz, das Urgesetz: So wie es im Himmel ist, soll es auf Erden sein.«
Der 50-jährige Johannes ist der Abt von Kloster Buchhagen, einer versteckten Klausur im Weserbergland. Er wuchs im Kurhessischen auf, studierte in Berlin Kirchenmusik, Religionswissenschaften, Byzantinistik und Theologie. Da sei er noch »auf der Suche gewesen«, erzählt er. Auf der Suche danach, »wie ich mein irdisches Leben mit der gewaltigen Herrlichkeit im Himmel in einen vernünftigen Einklang bringen kann«. Denn 16-jährig sei er religiös geworden; er hatte mit Gott gesprochen, doch Antwort auf seine drängenden Fragen fand er bei seinem Pfarrer nicht: »Religionsunterricht hatte mit dem Rest des Lebens nichts zu tun.«
Das Studium habe dann seinen Drang verstärkt, »zu den Ursprüngen der Dinge zurückzukehren, ganz zurück zu Gott«. Und das hieß für ihn, sich auf die Anfänge des Christentums zurückzuziehen, den orthodoxen – zu deutsch: geradlinigen, rechten – Lobpreis Gottes.
Der Abt bittet zu einer Visite durch die heilige Gruft. Weihrauch liegt in der Luft. Die Lampen brennen mit geweihtem Öl; hier und da erhellen sie Fresken mit Engeln und Heiligen. Die Krypta ersetze vorerst die Kirche, die sie oben drüber erst noch bauen müssten, entschuldigt er sich. Doch die Bitte um Nachsicht ist unangebracht. Was er mit seinen Mönchen und weiteren Helfen nach dem Vorbild frühorthodoxer Tempel eigenhändig in den Sandstein trieb, beeindruckt mehr als die Ikonen an den Wänden. In jahrelanger Arbeit ertrotzten sie dem Fels Raum für Königspforte, Altartisch und Chorgestühl, in dem orthodoxe Christen traditionell stehend beten. Hinten an einer Wand ein Vorhang: Er führe zum Altarraum und sei nur für Priester zugänglich, teilt Johannes mit. Links und rechts davon große Bilder von Christus und Maria.
In der Mitte der Krypta bleibt er vor einem dicken, altertümlich wirkenden Buch stehen, das auf einem Pult ruht. Es ist der Ambo; von hier aus bekommen orthodoxe Christen das Wort des Herren verkündet. Er bittet, näher zu treten – und überrascht erneut. Denn der heilige Wälzer ist in gepflegtem Deutsch gehalten.
Und eben das ist es offenkundig, was Johannes dazu trieb, für die rund 1,2 Millionen orthodoxen Christen in Deutschland noch ein weiteres Kloster zu gründen – das nunmehr fünfte, neben zwei russischen und je einem serbischen und rumänischen. Denn hier tritt man konsequent auf Deutsch mit Gott in Verbindung. »Für uns ist auch die deutsche Sprache heilig, anders als bei Juden und Muslimen, die nur eine heilige Sprache haben«, betont er.
Viel zu tun in der reinen Männerwirtschaft
Die Idee zur Stiftung jenes Deutschen Orthodoxen Dreifaltigkeitsklosters brachte er Ende der 1980er Jahre vom Heiligen Berg Athos in Griechenland mit, wo er zwei Jahre lang Novize war und dann Diakon und Mönch wurde. Seither widmet er sich einer doppelten Lebensaufgabe: einerseits dem eigenhändigen Ausbau des 1990 gegründeten Klosters, das seit 1994 zum Bulgarischen Patriarchat gehört, und andererseits der Vervollkommnung des von ihm entwickelten Deutschen Chorals. Denn damit hält nunmehr auch das Deutsche Einzug in die göttliche Liturgie der orthodoxen Kirche. Johannes' bürgerlichen Namen Pfeiffer kennen heute nur noch wenige.
Dank jener deutschen Choräle erfuhr auch Vater Lazarus erstmals vom Kloster in den Weserbergen. Da arbeitete der 29-jährige noch als Physiotherapeut in Leipzig. Erst nach der Wende ließ sich der damals 14-Jährige taufen, haderte bald aber mit dem Gottesbild der Protestanten. Ihn drängt es zu mehr authentischer Frömmigkeit, landete so in einer rumänisch-orthodoxen Gemeinde. Hier seien ihm dann liturgische Texte von Abt Johannes in die Hände gekommen, erzählt Lazarus, während er im Klostergarten werkelt, der einen gehörigen Teil des 5,5 Hektar großen Klostergeländes ausmacht. Alles was die ebenso karge wie gesunde Klosterküche benötigt, wird hier selbst angebaut – von Kartoffeln bis zu Gewürzen.
Es sei halt viel zu tun in solch einer reinen Männerwirtschaft: »Ora et labora.« Beten und Arbeiten – das uralte mönchische Prinzip gelte auch hier. Das Klosterleben hat es in sich. Morgens um 4 Uhr endet die Nacht. Der Tag beginnt mit Morgen- und Herzensgebet, es folgen das Frühstück und anschließend immer wieder Gebete sowie viel Arbeit: Garten- und Landschaftspflege, diverse Haushalt- und Küchenpflichten, Ikonenmalerei, Übersetzungen aus dem Griechischen, Seelsorge sowie die Betreuung von Gästen gehören dazu. Denn regelmäßig nächtigen in Buchhagen auch junge Männer, um mal ein wenig in den Klosteralltag zu schnuppern. Auch der Abt muss hart körperlich ran, selbst wenn dieser auf Athos bereits die Weihe des großen engelgleichen S'chima erfuhr. Vor allem arbeitet er aber weiter am Deutschen Choral. Mittlerweile nahmen die Buchhagener Mönche auch schon eine CD mit ihren Gesängen auf.
Durch das Klausurgebäude zieht derweil der Duft von Grünen Bohnen. Es ist langsam Essenszeit. Vater Simeon hat gekocht. Schließlich ruft der Abt zu Tisch. Dieser besteht aus stabiler Eiche, ebenso das Gestühl. Die Mönche sprechen ein Tischgebet, dann gibt der Abt die Tafel frei. Die Bohnen sind gut gewürzt; wer es milder mag, gibt etwas Joghurt hinzu.
Nach dem Mahl führt Johannes in die Kapelle in einem Flügel des Haupthauses. Auch hier wähnt sich der Gast wie in einem historischen altgriechischen Bettempel. Und man mag schlichtweg nicht glauben, dass die kleine Mönchsgemeinschaft das alles selbst gebaut hat. Weil das Geld dazu fehlte, hätten sie das zwölf Meter hohe Haupthaus sogar ohne Gerüst hochgezogen, erzählt der Abt. Auch die drei Meter hohen Öffnungen für die Rundbogenfenster mauerten sie praktisch freihändig, nur mit Zollstock und Wasserwaage.
Nun sind sie aber weitgehend fertig. Nur eine Kirche muss halt noch errichtet werden, sofern die nötigen Baumaterialien zusammen sind. Im Übrigen sei auch noch Platz für weitere Mönche, beteuert der Abt. Bewerbungen gebe es auch hin und wieder. Aber freilich nehme man nicht jeden, betont er selbstbewusst. »Man muss schon einiges mitbringen – die Liebe zu Gott wie das Vermögen, handfest mit einem Spaten umzugehen. Also gut bei Troste sein.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.