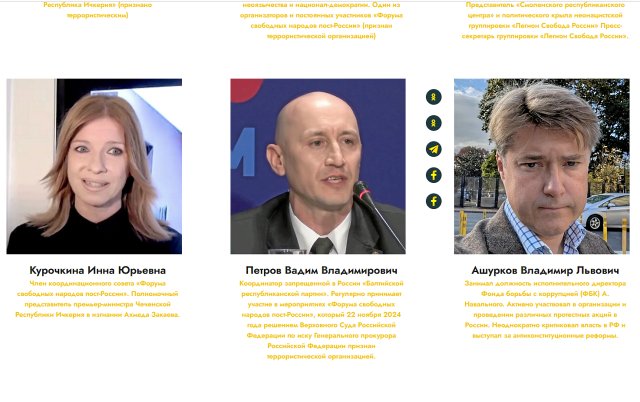Litauens Expräsident Opfer der CIA?
Paksas will Geheimgefängnis abgelehnt haben
Glaubt man Rolandas Paksas, herrschen im EU-Staat Litauen Verhältnisse wie in einer Bananenrepublik. Bei den Präsidentschaftswahlen 2003 hatte sich Paksas gegen Amtsinhaber Valdas Adamkus durchgesetzt. Doch bereits ein Jahr später wurde er wegen Amtsmissbrauchs vom Parlament abgesetzt, und Adamkus kehrte an die Macht zurück.
Adamkus lebte und arbeitete von 1949 bis 1997 in den USA – unter anderem für den militärischen Geheimdienst. Als Präsident Litauens unterstützte er die prowestlichen Kräfte in der Ukraine und Georgien. Paksas galt in Washington dagegen als unsicherer Kantonist. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt berichtete die Presse über zwielichtige Verbindungen des Präsidenten zu russischen Unternehmern. Paksas hatte dem russischen Geschäftsmann Juri Borissow zur litauischen Staatsbürgerschaft verholfen – als Dank für dessen Wahlkampfspenden. Im März 2004 leitete das Parlament ein Amtsenthebungsverfahren gegen Paksas ein.
Die Verfehlungen des Kurzzeitpräsidenten waren gravierend. Der wahre Grund für die Veröffentlichung der Informationen, die der Geheimdienst geliefert hatte, sei jedoch sein Widerstand gegen die Errichtung geheimer CIA-Gefängnisse gewesen, sagte Paksas am vergangenen Freitag vor einem Untersuchungsausschuss des Parlaments. Der Ausschuss wurde eingesetzt, nachdem der USA-Sender ABC im August erstmals von einem CIA-Gefängnis in Litauen berichtet hatte. Darin sollen zwischen 2004 und 2005 mutmaßliche Terroristen verhört worden sein. Zehn Kilometer nordöstlich von Vilnius kaufte die CIA mittels einer Tarnfirma einen alten Pferdestall. Wo einst Tiere gehalten wurden, entstand ein Zellentrakt für Terroristen.
Sein Geheimdienstchef habe ihm das Ansinnen der CIA im Frühling 2003 vorgetragen, erklärte Paksas nun. Pikant dabei: Sein Amtsvorgänger Adamkus hatte den USA bereits 2002 seine Unterstützung in der Sache zugesagt, berichtete ABC. Washington soll Vilnius dafür einen zügigen NATO-Beitritt versprochen haben. Paksas will die Errichtung geheimer Gefängnisse jedoch abgelehnt haben. Er gab sich am Freitag als Opfer einer Geheimdienstverschwörung: »Meine prinzipielle Ablehnung (der CIA-Gefängnisse) und der antipräsidiale Umsturz sind direkt miteinander verbunden«, betonte der heutige EU-Parlamentarier.
Ganz aus der Luft gegriffen scheinen seine Aussagen nicht zu sein. Mit welchen Bandagen Washington und Moskau im Baltikum um Einfluss ringen, zeigen auch andere Beispiele – etwa der Kampf um die Übernahme der Erdölraffinerie Mazeikiu Nafta. Der damalige USA-Präsident George Bush bat seinen Kollegen Adamkus 2001 brieflich, keine russischen Investoren an der Privatisierung der Raffinerie zu beteiligen. Bush erinnerte Litauen auch bei dieser Gelegenheit an seine NATO-Beitrittswünsche. Als der Brief öffentlich wurde, trug er dazu bei, dass die Litauer bei den Präsidentschaftswahlen 2003 für Paksas stimmten.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.