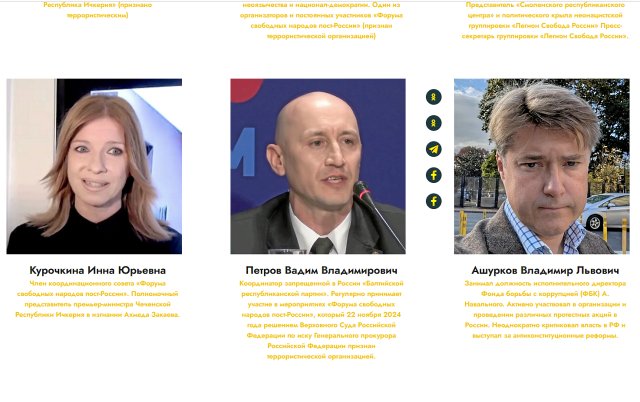Wie Armut Jobs schafft
Experten beleuchten soziale Lage in Hamburg
Wer vor 25 Jahren prophezeit hätte, dass in absehbarer Zeit in Deutschland Menschen vor Suppenküchen, Kleiderkammern und Lebensmittelausgaben Schlange stehen würden, wäre vermutlich entweder milde belächelt oder als nicht lernfähiger Altlinker bezeichnet worden. Inzwischen ist das Thema Armut auch bei Teilen der Mittelschicht angekommen. Auch mancher Akademiker muss mittlerweile den schweren Gang zur Arge gehen. So alt wie die Armut ist wohl auch die Armutsforschung. In Hamburg kamen in der vergangenen Woche rund 250 Menschen unter dem Motto »Hamburg: Eine Stadt für alle!« in das Bürgerhaus Wilhelmsburg, um an einer »1. Konferenz zur sozialen Spaltung« teilzunehmen. Auf diesen ersten Kongress soll ein zweiter in etwa einem Jahr folgen.
Betroffene fehlten
Neun Wissenschaftler hielten Vorträge zu Themen wie »Soziale Spaltung in Hamburg: Bilanz und Perspektiven«, »Wohnen: Aufwertung und Verdrängung« oder »Ordnungspolitik und öffentlicher Raum«. Eingeladen hatten die Evangelische Akademie der Nordelbischen Kirche, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, das Hamburger Institut für Sozialforschung und gar das Institut für Soziologie der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr. Die Tagung wurde gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Deutlich wurde: Es wurde wieder »wissenschaftlich« über Arme und Armut gesprochen. Die von Armut betroffenen waren entweder nicht anwesend oder es war es ihnen peinlich, sich zu outen. Stattdessen waren diejenigen gekommen, die beruflich mit diesem Thema zu tun haben wie etwa Stadtplaner, Sozialarbeiter, Soziologen und Politologen. Zudem fehlten Handlungsalternativen – sowohl für eine oppositionelle Politik als auch für die Betroffenen. Zumal sich diese durchaus wehren – legal durch Prozesse und Einsprüche gegen willkürliche Bescheide sowie durch »illegale« Nebenjobs.
Mit der Armut wuchsen auch die Programme zu deren Bekämpfung. So legte die Hansestadt Hamburg ab 1994 mehrere millionenschwere Programme zur Armutsbekämpfung in den Stadtteilen auf, erläuterte Prof. Ingrid Breckner von der HafenCity Universität. Dabei änderten sich je nach politischer Couleur die Namen der Programme. War Mitte der 90er Jahre noch von einem Armutsprogramm die Rede, wurde ein paar Jahre später das anstößige Wort gestrichen und durch Soziale Stadtteilentwicklung ersetzt. Auch dieser Begriff hielt sich nicht lange, nunmehr spricht man in Hamburg schamhaft von der Aktiven Stadtteilentwicklung.
Bei dem Versuch, den Erfolg all dieser Maßnahmen zu ergründen, stieß die Wissenschaftlerin auf ungeahnte Probleme. Danach es sei schwierig gewesen, bei Behördenmitarbeitern überhaupt fundierte Ergebnisse ihrer Programme zu erhalten, ebenso bei den beauftragten Firmen, dem »Quartiersmanagement«. Dieses zeigte sich loyal gegenüber den behördlichen Auftraggebern und geizte ebenfalls mit detaillierten Informationen.
Prekäre Verhältnisse
Nebenbei wurde deutlich, dass Armut auch Jobs schafft, so Breckner: »Ganze Heerscharen von Beschäftigten arbeiten in diesen Projekten.« Wobei diese Beschäftigten auch selbst oftmals in prekären Anstellungsverhältnissen arbeiten, immer auf der Suche nach dem Anschlussauftrag. Einige der Forscher schließlich räumten mit gängigen Vorurteilen auf wie etwa, Arme könnten nicht mit Geld umgehen, würden es für teure Handys und Großbildschirme verprassen. So erklärte Wolfgang Völker vom Diakonischen Werk Hamburg: »In armen Haushalten sparen die Eltern in der Regel zugunsten ihrer Kinder.« Damit unterscheiden sie sich übrigens wohltuend von den Haushaltspolitikern der herrschenden Parteien.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.