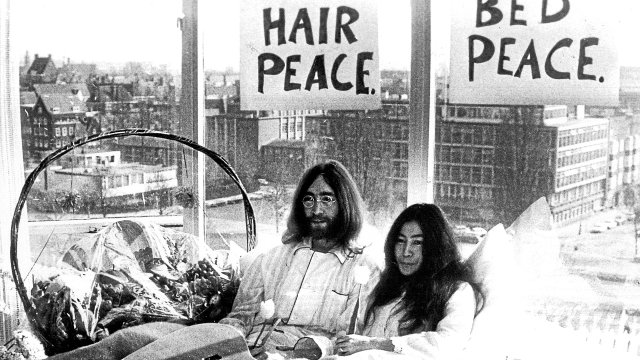Schmutzig schillerndes Reich
Theatertreffen Berlin: »Kasimir und Karoline« aus Köln
Ich empfand diesen Abend als grob. Als könne man diese Tragödie erzählen, ohne die ihr zugrunde liegende Ordnung zu verachten. Johan Simons und Paul Koek, sein musikalischer Partner, haben Ödön von Horváths »Kasimir und Karoline« am Schauspiel Köln inszeniert. Die Geschichte der beiden, die sich auf dem Rummelplatz für immer verlieren, weil der soziale Minderwertigkeitskomplex die Seelen zerfrisst, Missverständnisse schürt und die Sprache zu Steinen zermahlt, die sich die Menschen, in Härte verwirrt, gegenseitig an die Herzen werfen – diese Geschichte ist Revue und emotionaler Schredder, sie sieht die Menschen wohl eher als listig auf Lust Lauernde denn als ohnmächtig Ausgelieferte.
Merkwürdig: So sehr das eine ganz eigene Kraft hat, so sehr fehlt der Aufführung Wärme, ohne die keine wirkliche Liebesgeschichte erzählt werden kann. Wärme, die in Eis und Kälte eingeschlossen sein kann wie in einem beschlossnen Grab, aber sie muss durch alle Schichten pochen. Bei Marthaler war's so, vor vielen Jahren, mit dem Bierbichler und der Grigolli. Brutal, aber beseelt. Beseeltheit ist Simons fremd.
Sein großartiger Kasimir, Markus John, ist ein schmieriger Kühl-Schrank. Dem ist eingeschrieben, dass er nur von einer Karoline geliebt werden kann, die ihrerseits frei ist von allzu großer Lieblichkeit. Die Karoline der Angelika Richter schielt von Beginn an auf die durchtriebene Romantik einer Reeperbahn; das verletzte Zarte, das die Traurigkeit des Stücks ausmachen könnte, ist getilgt. Hier schlagen Herzen, aber nur zurück wie Fäuste.
Bert Neumann hat eine Gerüstbühne gebaut, oben steht in glitzernden Lettern »Enjoy«. Das ist der Wink mit der Deutlichkeit. Eine Rockband schrillt. Die Menschen da auf dieser Bühne verwalten ihre Leere. Das brillant, aber auch zu Gleichförmigkeit gepresst. Simons gestattet kein Mit-Fühlen, ein Labor-Besitzer führt uns durch sein schmutzig schillerndes Reich. Es scheint ihm darauf anzukommen, just den Verarmten und Ausgestoßenen, den Verlierern der Gesellschaft einen Nimbus zu entreißen (als ob sie einen hätten) – es kommt wohl darauf an, Kritik am Kapitalismus zu üben, ohne in »Ranschmeiße an das Prekariat« zu verfallen, wie es im »Spiegel« heißt.
Seelenarbeit ist das nicht gerade, aber an Horváth denken und seine Menschen noch innig fühlen zu können, obwohl sie den Dreck fressen, in den man sie stieß – es ist möglicherweise ein altmodischer Reflex, und Simons Regie ist modern, und demnach kann geschehen, dass man zueinander nicht findet. Also kann man eine Inszenierung bestaunen, ihr zunehmend gebannt zuschauen – und trotzdem einen inneren Stachel wider sie spüren. hds
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.