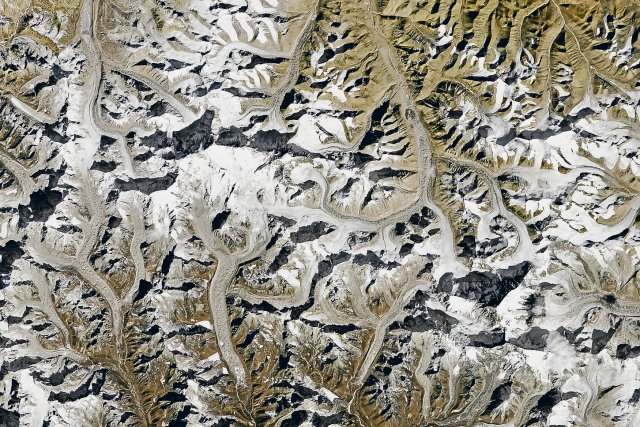Berliner »Studentenpack«
Ausstellung wirft einen kritischen Blick auf 200 Jahre Studentenbewegungen
»Studentenpack« lautete das Schimpfwort von Konservativen, die sich nach 1968 von den Aktivitäten aufbegehrender Universitätsabsolventen gestört fühlten. Wenn der Begriff zurzeit auf Plakaten im Berliner Straßenbild auftaucht, wird damit allerdings für eine Ausstellung geworben, für die der Begriff »in Bewegung bleiben« gleich in doppelter Hinsicht gilt. Da die Ausstellung auf sechs Etagen im Hegelgebäude der Berliner Humboldt-Universität verteilt ist, sollte der Betrachter viel Zeit mitbringen. Denn auf den Tafeln wird man über die durchaus nicht nur fortschrittliche Geschichte der Studierenden und ihrer Bewegungen in den letzten 200 Jahren in Berlin informiert.
So wird an die schon Mitte des 19. Jahrhundert beginnende Kampagne gegen polnische Kommilitonen erinnert. »Die Ausländerinnen erdrücken uns durch die Überzahl«, wird eine Medizinstudentin Anfang des 20. Jahrhunderts in der Ausstellung zitiert. Dabei hatten auch Frauen nach der Meinung vieler Studentenverbände nichts an den Universitäten verloren. Manche der Kommilitoninnen forderten ihr Recht auf ein Studium deshalb mit ihrem Status als deutsche Frau ein.
Auch die jüdischen Studierenden wurden schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts diskriminiert, verbal und zunehmend auch tätlich angegriffen. Der Antisemitismus am Campus der Berliner Hochschule wird in der Ausstellung gründlich dokumentiert. So unterschrieben 1880 fast 20 Prozent der damaligen Studierenden an der Berliner Universität eine Petition gegen die Gleichstellung der jüdischen Kommilitonen. Die Novemberrevolution 1918 änderte an der reaktionären Grundstimmung an der Universität wenig. Einem Rat sozialistischer Studierender, die die Revolution unterstützte und am Dach der Universität die rote Fahne hissen ließ, wurde schon nach wenigen Tagen vom Rat der Volksbeauftragten das Recht aberkannt, als Vertretungsorgan der Berliner Studierenden zu fungieren. Dafür hatten die massiven Proteste der konservativen Studierenden gesorgt. Nicht wenige von ihnen kämpften 1919 als Freiwillige in den Freikorps gegen die Arbeiteraufstände oder schlossen sich 1920 dem Kapp-Putsch für die Abschaffung der Republik an. Ein jüdischer Kosmopolit wie der Mediziner Georg Friedrich Nicolai wurde 1920 vom akademischen Senat als »moralisch unwürdig« klassifiziert, weil er während des 1. Weltkriegs in der Schweiz alle Europäer gegen den Krieg aufgerufen hatte.
Wer diese in der Ausstellung gut belegten Fakten kennt, wundert sich nicht mehr über die freiwillige Gleichschaltung der Universität im Nationalsozialismus. Am Beispiel der Juristin Erna Proskauer werden Kontinuitäten bis in die Nachkriegszeit deutlich. 1956 verweigerte das Bundesverfassungsgericht der aus dem Exil zurückgekehrten Frau eine Entschädigung für ihre Entlassung als angehende Juristin im Jahr 1933. Als Frau und mit ihren Notendurchschnitt hätte sie sowieso keine Chance auf eine Verbeamtung gehabt, lautete die zynische Begründung der Richter.
Die beiden unteren Etagen sind den aktuelleren Studierendenbewegung gewidmet. Dort werden am Beispiel der Geschichte von studentischen Publikationen die unterschiedlichen Wege der Protestszene dokumentiert. Während die im Westberliner Universitätsstreik von 1989 gegründete »Faust« Mitte der 1990er Jahren ihr Erscheinen einstellte, mutierte die »Unaufgefordert«, ein Produkt des Ostberliner Wendeherbstes am Campus, zum Life-Style-Magazin. Mittlerweile ist das Internet zum wichtigen Medium geworden.
Die Ausstellung »stud. Berlin – 200 Jahre Studieren in Berlin« ist bis zum 23. Dezember 2010 im HU-Seminargebäude am Hegelplatz (Dorotheenstr. 24) von Mo-Fr, 8-22 Uhr und Sa., 10-18 geöffnet. Der Eintritt ist frei. Im Internet: www.studierbarkeit.de
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.