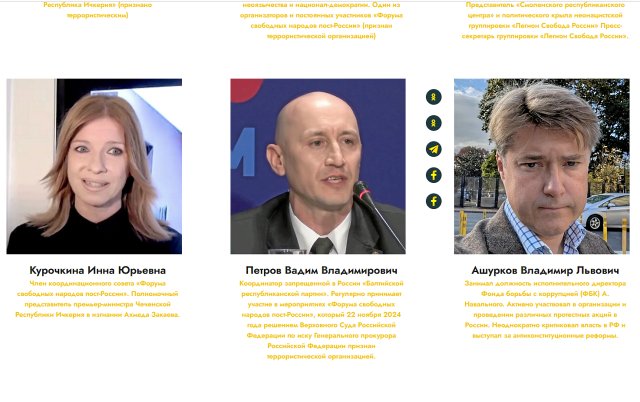Arabische Welt zwischen Aufbruch und Krieg
Friedensgutachten 2011 warnt vor »unkalkulierbarer Eskalation« in Libyen / Scharfe Kritik an Politik der EU
25 Jahre Friedensgutachten, das war für die Vertreter der wichtigsten Konfliktforschungsinstitute hierzulande auch Grund, sich am Dienstagabend gemeinsam mit Gästen aus Politik und Wissenschaft ein bisschen selbst zu feiern. Zu Recht, bietet ihr Jahrbuch doch immer wieder Erkenntnisgewinn und Stoff für kontroverse Debatten. In der Ausgabe 2011 sogar Anlass zu vorsichtiger Hoffnung.
Die Wissenschaftler sprechen von einem »revolutionären Aufbruch in der arabischen Welt«, von »einer historischen Zäsur«. Faszination und Breitenwirkung der Freiheitsbewegungen etwa in Tunesien und Ägypten gründeten darin, dass sie die reale Macht des Volkes erfahrbar machten. »Es gelang ihnen, übermächtig scheinende Autokraten aus dem Amt zu jagen. Diese Erfahrung vermittelte sich – auch dank der neuen Medien – weit über Nordafrika hinaus«, heißt es im Friedensgutachten.
Wenige Stunden nach den bisher schwersten NATO-Angriffen auf Tripolis mussten die Friedensforscher gestern in Berlin aber zugleich vor einer »unkalkulierbaren Eskalation« im Libyen-Krieg warnen. Die Militärintervention zeige immer deutlicher, dass sich der Schutz der Zivilbevölkerung und die Absicht der Interventen, das Regime zu stürzen, schwer vereinbaren lassen. Mit Blick auf die Abstimmung zur Durchsetzung der Flugverbotszone bestehe unter den Forschern Einigkeit darüber, »dass Deutschland im UN-Sicherheitsrat nicht glücklich agiert hat«, wie es Margret Johannsen vom Hamburger Friedensforschungsinstitut auf der Pressekonferenz ausdrückte. In der Sache werde die Haltung Berlins von den einzelnen Instituten jedoch unterschiedlich eingeschätzt.
Das Friedensgutachten erinnert daran, dass der Weltsicherheitsrat in seiner Resolution 1973 militärische Zwangsmittel allein autorisiert habe, um die Zivilbevölkerung zu schützen, und gleichzeitig eine sofortige Waffenruhe im Bürgerkrieg verlangt. Jetzt müsse ohne Vorbedingungen über ein Ende der Gewalt verhandelt werden. Und, so fragen die Konfliktforscher, warum sollte Deutschland dabei nicht zwischen Tripolis und Bengasi als Unterhändler vermitteln? Sie beklagen, dass noch immer »innenpolitische Parameter das außenpolitische Handeln der EU-Staaten bestimmen« und »nationale Alleingänge dominieren«.
Man dürfe nicht vergessen, dass sich die Europäische Union mitschuldig gemacht habe an der jahrzehntelangen politischen und sozialen Stagnation in der arabischen Welt – mit politischen Tauschgeschäften, bei denen Autokraten Erdöl und Erdgas lieferten, Flüchtlinge abfingen und dafür günstige Kredite sowie Waffen erhielten, hätten sich die EU-Staaten zu »Komplizen repressiver Regime« gemacht. Das Friedensgutachten fordert eine der Menschenrechtscharta verpflichtete Asyl- und Einwanderungspolitik sowie eine neue europäische Mittelmeerpolitik. In diesem Rahmen müsse die Union auch ihre Agrarmärkte öffnen. Dagegen verböten sich jegliche Rüstungsexporte in Spannungsgebiete und an Gewaltherrscher, wie es nachdrücklich heißt.
Die Wissenschaftler warnen zugleich davor, die Bundeswehr maßgeblich zu einer Interventionsarmee umzuformen oder Militäreinsätze zur Rohstoffsicherung vorzusehen. Die 6900 deutschen Soldaten im Ausland stünden mit wenigen Ausnahmen unter dem Kommando der NATO. Die Militärallianz jedoch sei kein Ersatz für die UNO-Friedenssicherung.
In Afghanistan etwa müssten sich die zivile Anstrengungen der militärischen Logik der Aufstandsbekämpfung unterordnen. Wer die Förderung von Entwicklungsprojekten an die Bereitschaft zu zivil-militärischer Kooperation binde, gefährdet Projekte wie Projektträger. Eine Befriedung der Lage verlange vielmehr Initiativen für regionale Waffenstillstandsvereinbarungen, um eine Abzugsperspektive glaubhaft mit dem Ziel der Beendigung militärischer Gewalt zu verbinden. Die Bundesregierung sollte sich auf der geplanten Petersberg-Konferenz im Dezember gerade hierfür starkmachen.
Scharfe Kritik gibt es auch an der EU-Flüchtlingspolitik. »Festungspolitik ist inhuman«, heißt es im Gutachten, das eine Reform des Einbürgerungsrechts und eine Asylpolitik in Übereinstimmung mit den Menschenrechten verlangt. Die Grenzschutzagentur Frontex gehöre unter die Kontrolle des Europaparlaments.
»In vielen europäischen Gesellschaften erzielten rassistisch, oft anti-muslimisch argumentierende Populisten Wahlerfolge mit der Stigmatisierung von Einwanderern«, kritisieren die Forscher. Gegen diesen wachsenden ausländerfeindlichen Populismus und Wählerfang am rechten Rand mahnt das Friedensgutachten Aufklärung und stärkeres europapolitisches Engagement aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Kirchen, Gewerkschaften und Regierung an. Angst vor Destabilisierung und Flüchtlingsströmen sei kein guter Ratgeber.
Kommentar Seite 8
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.