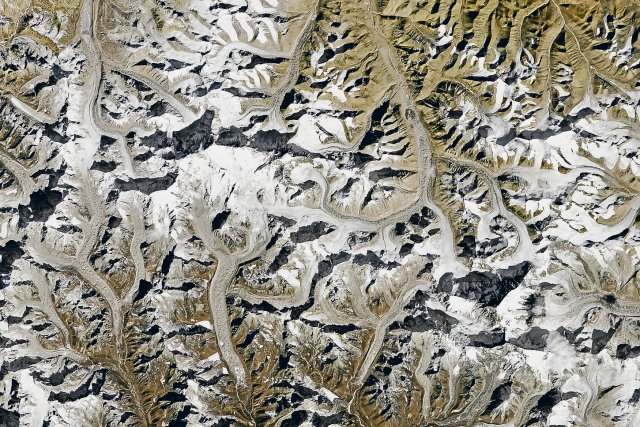»Mama, darf ich Computer?«
Kinder verbringen immer mehr Zeit mit dem PC, doch zu ihrem Schaden ist das nicht
Am Anfang kam das Schneemonster. Ein Wesen wie ein Wattebausch. Aus dem Nichts huschte es über den Bildschirm, verteilte Ohrfeigen und stibitzte Diamanten. Die mussten Kerstin und Timm erst vor ihm retten und dann zusammenzählen. Gelang das, schallte ein schepperndes »Pling« aus dem PC-Lautsprecher, wie man es sonst nur von Steinzeit-Registrierkassen kennt. Der Signalton für die beiden Vorschulkinder: Alles richtig gemacht! »Rechenkünstler auf Schatzsuche« hieß dieser Ur-Opa heutiger Computer-Lernprogramme. Zwei-, dreimal pro Woche durften Kerstin und Timm sich damit am elterlichen PC durchs kleine Einmaleins klicken.
Öfter wollten sie gar nicht. Lego, Schaukel und Sandkiste waren interessanter. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass die beiden noch gar nicht reif waren für erste Klicks am PC? Auf diese Frage gibt's bis heute keine für Eltern eindeutige Antwort. Das Bundesfamilienministerium findet es sinnvoll, wenn schon Dreijährige erste Tippversuche auf der Tastatur machen. Thomas Feibel, einer der renommiertesten Tester und Experte von Kinder-Computerspielen wiederum hält ein Einstiegsalter von fünf bis sechs Jahren für sinnvoll.
Wann auch immer es losgeht: Windows ist ein Betriebssystem und kein Babysitter. Allein kommen Kinder vorm PC nicht klar, sie brauchen helfende Hände und elterliche Unterstützung. Schließlich drückt man ihnen ja auch nicht kommentarlos die ersten Bilderbücher in die Händchen, sondern zeigt, welche Tiere drin sind und liest Gute-Nacht-Geschichten vor. Übersetzt auf den PC: Zuerst haben wir die kleinen, etwas unsicheren Finger noch zum Schneemonster geführt. Bei »Petterson und Findus« ließen sie die Kühe dann schon allein über den Stall fliegen – unter unseren wachsamen Augen. Als elterliche »Computer-Beifahrer« kriegt man so am meisten mit: wie viel Geduld Kinder am PC haben, ob ihnen irgendwann die Augen weh tun. Und: welche Spiele altersgerecht und welche einfach nur anstrengend und umständlich sind.
Doch plötzlich wurden die elterlichen Beifahrer gebeten, auszusteigen. Und die Fahrer stiegen um: Von Pettersons Trecker in aufgemotzte Rennwagen. »Need for Speed« heißt eines dieser Achterbahn-Spiele, das Timm als Zehnjähriger aus der Schule mitbrachte – »echt cool, Papa, hab ich von Leon«. Danach fiel jedes Lernspiel bei ihm durch. Eine normale Reaktion, meint Spiele-Experte Thomas Feibel: »Etwa ab der vierten Klasse gelten sie als uncool. Kinder merken, darin wird ihnen immer eine Portion Schule untergejubelt. Was Eltern kaufen, lehnen sie ab jetzt ab, der Schulhof wird zum Schwarzmarkt für Software.«
Ein Grund dafür: Immer früher besitzen Kinder Handy oder Fernseher, wollen zu »den Großen« dazugehören. »Age Compression« nennen Experten dieses Phänomen des immer früheren Erwachsenwerdens. Das vielleicht wichtigste Statussymbol in dieser Phase: Der PC im Kinderzimmer. Kaum war er angeschlossen, wollten Kerstin und Timm ihn zum Unabhängigkeits-Symbol machen: Tür zu und spielen bis die Augen zuklappen. Nein, das haben wir gleich geknickt. Dachten wir jedenfalls, als wir folgende Regeln aufstellten: Erstens: Spielen am Computer täglich höchstens eine halbe Stunde. Zweitens: Vorher sind die Hausaufgaben fertig und ein paar Lektionen in Computer-Lernprogrammen absolviert. Wenn diese gut sind, dann haben sie unbestechliche Kontrollfunktionen: nur was grün erscheint, ist richtig bearbeitet. Darauf haben wir uns jedoch nur kurz verlassen. Denn was nützt diese Funktion, wenn man abends, kurz vorm Schlafengehen der Kinder rotes, unbearbeitetes Brachland im Grammatik-Teil entdeckt, weil der Nachwuchs in den unbefristeten Lernspiel-Streik getreten ist. Um sicherzustellen, dass erst Vokabeln und dann Verfolgungsjagden über den Bildschirm flimmern, führten wir regelmäßige Streifengänge ins Kinderzimmer ein. Und merkten sehr schnell: Überwachung und Zwang allein führen auf Dauer auch nicht zum Ziel. Aber vielleicht ein unverstellter Blick darauf, was unsere Kinder da am PC spielen wollen.
So lernten wir zusammen mit Kerstin die Nachbarschaft kennen – die virtuelle, im Spiel »Die Sims«: Wie in einer Seifenoper geht es da zu, die Spieler bewegen sich in der Miniwelt aus einigen Häusern, man kann vorhandene Charaktere übernehmen, sie formen, seine eigene Familie gründen, und wenn man nicht aufpasst, dann pinkelt einer der Mini-Sims schon mal in die Ecke, weil er nicht per Mausklick zur Toilette geführt wurde. Diese Software-Soap ist weltweit immer noch eines der erfolgreichsten PC-Spiele. Hirnforscher Henning Scheich glaubt, dass es förderlich für Kinder ist, weil es ihre Hirnentwicklung positiv beeinflussen kann: Neuronennetze könnten im Kopf besser verknüpft werden, das fördere strategisches und kreatives Denken, meint Scheich, der am Magdeburger Leibniz-Institut für Neurobiologie die Grundlagen des Lernens erforscht.
Aber sollte das auch für Timms Ballerspiele gelten, in denen ganze Armeen über den Monitor marodieren? Sind sie etwa nicht gewaltverherrlichend, abstumpfend und schädlich für Kinder? »Nicht generell«, meint Spiele-Experte Thomas Feibel und weist darauf hin, dass solche Armeen in Kinofilmen vor einem Familienpublikum kämpfen. »Action ist das Salz in der Suppe vieler Computerspiele«, sagt Feibel. Eltern sollten daher genau hinschauen, ob auf dem PC ein konstruktives Spiel läuft, in dem es etwa gilt, einen Staat zu errichten, der dann von Eindringlingen bedroht wird und verteidigt werden muss. Oder ob es sich um ein destruktives »Ego-Shooter«Spiel handelt, in dem Kinder als virtuelle Rambos im Sekundentakt ohne Sinn und Verstand Gegner niedermetzeln. Solche zumeist extrem brutalen Spiele haben nichts auf Kindercomputern zu suchen. Trotzdem: einfach wegnehmen ist falsch. Kinder brauchen unaufgeregte Erklärungen, warum »Counterstrike« & Co destruktiv und menschenverachtend sind.
Spätestens seit der Pubertät ist klar: Der PC ist für unsere Kinder zu einer Art Regiepult ihres Alltags geworden: Spiele gegen Langeweile, Heimkinoprogramm und Musik per Download, quatschen, lästern und verabreden via Chat. Einen regelrechten Live-Stream zur Außenwelt richteten sie sich ein. Als wir ihn kappten, ernteten wir bittere Vorwürfe: Alle anderen in der Clique seien weiter »on«, jammerten die beiden und befürchteten, nun als Außenseiter in ihren Cliquen nichts mehr mitzukriegen. Wir dachten an früher. Wer »Miami Vice« nicht sehen durfte, hatte mittwochs auf dem Schulhof ja auch nicht viel zu melden.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.