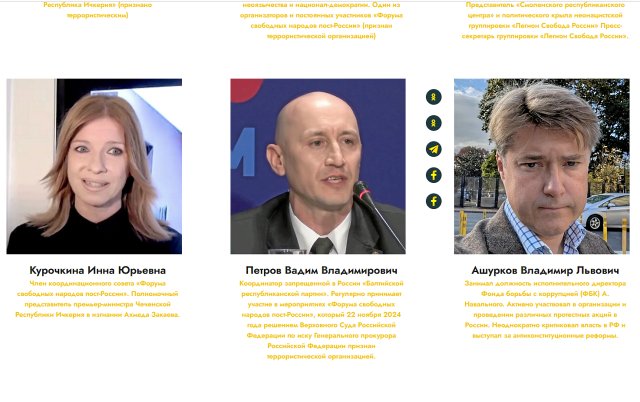Zweigleisige deutsche Außenpolitik
Wie Berlin Demokratie nach Belarus exportiert
Ende vergangener Woche hatte die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Brandenburg zu einem zweitägigen Kolloquium zur deutschen Außenpolitik gegenüber Staaten Osteuropas eingeladen. Die wechselnden Podien waren gut besetzt. Unter anderem mit Dr. Patricia Flor. Sie ist nach Einsätzen in Kasachstan, bei der UN und als Chefin der Vertretung im kriegerischen Georgien Beauftragte des Auswärtigen Amtes (AA) für Osteuropa, den Kaukasus und Zentralasien.
Geradezu begeistert schilderte sie die Möglichkeiten der strategischen Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland. Alles, was sich so positiv entwickle, entstehe stets auch im Bewusstsein der besonderen deutschen Verantwortung gegenüber den russischen Partnern, betonte Flor.
Eine Verantwortung, die, so möchte man meinen, nicht geringer ist in den Beziehungen zu anderen ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Doch wenn es um die Ukraine und um Belarus gehe, gebe es keinen Grund zur Euphorie, sagte die Botschafterin. Vorwürfe, die deutsche Außenpolitik lasse das Prinzip der Gleichbehandlung von Staaten vermissen und unterscheide Diktatoren nach Nützlichkeit, wies die Frau aus dem Westerwelle-Amt zurück. Ebenso ließ die Botschafterin - die nach dem wahrlich nicht sehr demokratisch zustande gekommenen Präsidentenwahlergebnis den belarussischen Botschafter einbestellte - Vorhaltungen über eine angebliche Einmischung in »innere« Angelegenheiten fremder Staaten zurück.
Deutschland verfolge gegenüber Minsk eine zweigleisige Politik. Die man zumindest als Gratwanderung bezeichnen muss. Verstöße gegen die Menschenrechte werden mit Sanktionen geahndet. Auf der anderen Seite unterstütze man aktiv, doch nicht sehr lautstark die sogenannte Zivilgesellschaft. Also die Opposition gegen Lukaschenko.
Die Mittel der Unterstützung teilen sich das AA und das - in solchen Fragen oft übersehene - Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Beide FDP-geleiteten Regierungsstellen unterstützen die belarussische Zivilgesellschaft in diesem Jahr mit 6,6 Millionen Euro. So finanziert das BMZ beispielsweise mit 840 000 Euro die Internationale Bildungs- und Begegnungsstätte »Johannes Rau« in Minsk. Für die Arbeit politischer Stiftungen in Belarus, von denen man in den hiesigen Medien kaum Notiz nimmt, stehen knapp 800 000 zur Verfügung.
Das Außenministerium, so bestätigte jüngst die zuständige Staatssekretärin Emily Haber, öffnet in Richtung belarussische Opposition ihre Kasse für Krisenprävention, Friedenserhaltung und Konfliktbewältigung (Haushaltskapitel 0502, Titel 68774). Argwöhnisch betrachten die Lukaschenko-Wächter auch die offene deutsche Unterstützung für unabhängige Medien in Belarus mit immerhin 200 000 Euro pro Jahr. Gefördert werden ebenso Visumerleichterungen für diverse zivilgesellschaftliche Gruppen.
Angesichts solcher Bemühungen reduzieren sich freilich die Aufwendungen zur Verbesserung des Deutschlandbildes in Belarus. Dafür stehen gerade einmal 20 000 Euro zur Verfügung.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.