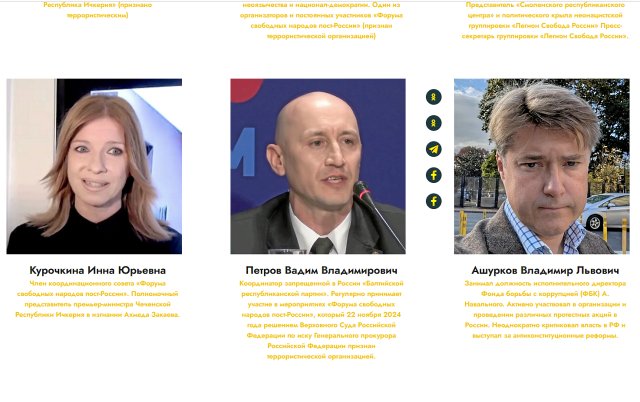Chronik eines Pogroms: Samstag, 22. August 1992
Es war klar, dass an diesem Wochenende etwas passieren würde. Das hatte bereits am Freitag, den 21. August 1992, ein Artikel in der »Ostseezeitung« offen angekündigt. Jeder Zeitungsleser in der Hansestadt konnte wissen, dass »die Rechten die Schnauze voll haben«, dass »die rumänischen Roma ›aufgeklatscht‹ werden« sollen. Es war noch nicht einmal der erste derartige Artikel in der Nordost-Regionalpresse. Jeder wusste Bescheid - nur die Polizei war angeblich nicht vorbereitet.
Ein gutes Jahr zuvor war die »Zentrale Aufnahmestelle« (ZASt) des Landes Mecklenburg-Vorpommern in dem dicht besiedelten Rostocker Stadtteil Lichtenhagen eröffnet worden, in einem der Hafengesellschaft gehörenden Hochhaus. Seit Monaten herrschen dort chaotische Zustände: Die Aufnahmestelle ist chronisch überlastet, stets campieren Dutzende Asylbewerber - die meisten von ihnen Sinti und Roma - auf der Wiese vor dem Haus in der Mecklenburger Allee. Ohne Essen, Unterkunft und Toiletten. Es stinkt dementsprechend; bei Regen schlafen die, die unter den Balkonen keinen Platz finden, in Unterführungen. In der nahen Kaufhalle kommt es vermehrt zu Mundraub.
Peter Magdanz, damals junger SPD-Innensenator und bis heute eine große Nummer im Rostocker Stadtmarketing, erklärt hinterher trotzdem, dass viele der Menschen auf der Wiese gar nicht obdachlos gewesen wären. Obwohl es sogar in Lichtenhagen geeignete Ausweichobjekte in öffentlichem Besitz gibt, schieben sich die SPD-regierte Stadt und das damals CDU-geführte Land die Verantwortung zu.
Ab dem Nachmittag versammeln sich 1000 bis 2000 Menschen vor dem Haus. Mindestens 100, nach anderen Angaben bis zu 500 von ihnen sind erkennbar rechte Skinheads. Der überwiegende Rest aber besteht aus Jugendlichen und Erwachsenen aus Lichtenhagen. Bereits an diesem Tag wird die ZASt ab etwa 20 Uhr mit Steinen, Brandflaschen, und sogar Leuchtspurmunition angegriffen. Mehrere Autos der Polizei und der vietnamesischen Vertragsarbeiter, die im Aufgang direkt neben der ZASt wohnen, gehen in Flammen auf. Bis in den vierten Stock werden die Scheiben eingeworfen.
Am rechtsradikalen Charakter der Angriffe kann es keinen Zweifel geben: Die Treffer am Sonnenblumenhaus werden mit »Sieg Heil«-Rufen und dem Sprechchor »Deutschland den Deutschen - Ausländer raus« begleitet. Im Nachhinein wird die Tatsache, dass von Anfang an organisierte Rechtsradikale den Ton angeben, hartnäckig geleugnet. Verschiedene CDU-Politiker fabulieren später sogar, hier hätten Rechts- und Linksradikale vereint agiert.
Dieser Text ist der erste Teil einer Chronik des rassistischen Pogroms vor 20 Jahren. Alle Artikel zu diesem Thema unter: www.nd-aktuell.de/lichtenhagen
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.