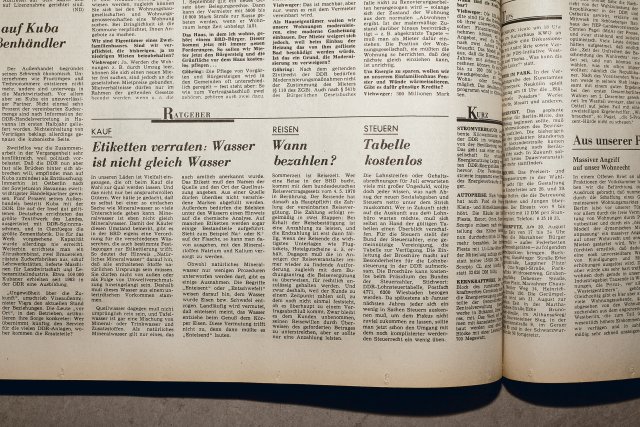Unser Autor, Rechtsanwalt Prof. Dr. ERICH BUCHHOLZ, erläutert in einer Beitragsfolge die Möglichkeiten des vorzeitigen Ausstiegs aus Verträgen, der vorzeitigen Beendigung von Schuldverhältnissen.
Im Absatz 2 des neuen § 313 BGB (Rechtsanspruch auf Anpassung des Vertrages) ist die vorgenannte, Abs. 1 enthaltene Regelung sogar auch dann vorgesehen, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, sich als falsch herausstellen.
Schließlich wird im Abs. 3 dieses neuen § 313 für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung (unter den vorgenannten Voraussetzungen) eingeräumt.
Dem entspricht, dass der darauf folgende ebenfalls neugefasste § 314 BGB mit der Überschrift »Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund« dieses außergewöhnliche Kündigungsrecht ausdrücklich regelt.
Nach dieser Vorschrift liegt ein wichtiger Grund, der zur Kündigung berechtigt, dann vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der Parteien die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur ursprünglich vereinbarten Beendigung oder bis zum Ablauf einer gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.
Diese Kündigung aus wichtigem Grunde kann der zur Kündigung Berechtigte jedoch nur innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat, erklären. Allerdings sollte man sich des absoluten Ausnahmecharakters dieser Möglichkeiten bewusst sein. Die vorgenannten Regelungen der neuen §§ 313 und 314 BGB dienen nicht dazu, gewöhnliche Fehlkalkulationen, gewöhnliche Risiken im Wirtschaftsleben, in der Marktwirtschaft zu korrigieren.
Auch ist zu beachten, dass grundsätzlich die im Gesetz und in den von den Parteien freiwillig abgeschlossenen Verträgen vorgesehenen Möglichkeiten der Beendigung oder Veränderung des Schuldverhältnisses gelten und zu nutzen sind.
Erst wenn diese nicht geeignet sind, das ernste wirtschaftliche Problem, das schwerwiegende Missverhältnis in der wirtschaftlichen Situation zwischen den Parteien auszugleichen, kann an die Geltendmachung des nunmehr in § 313 BGB gesetzlich geregelten Anspruchs auf Anpassung des Vertragsverhältnisses wegen Störung der Geschäftsgrundlage gedacht werden.
Das gilt etwa bei rechtlich gesicherten und rechtlich durchsetzbaren Einkünften des Vermieters auf der einen Seite und aber der Ausfall der zur Gewährleistung der Mietzahlung benötigten Einnahmen auf der anderen Seite.
Wenn es nicht gelingt, mit dem Vertragspartner eine für beide Seiten verträgliche Lösung zu finden, (ggf. durch Abschluss eines neuen, anderen Vertrages) kann der Weg zum Gericht versucht werden. Allerdings darf nicht davon ausgegangen werden, dass vor Gericht regelmäßig eine Beendigung des Dauerschuldverhältnisses, etwa des gewerblichen Mietverhältnisses, erstritten werden kann.
Auch eine Lösung in der Richtung, dass entweder die Höhe des Mietzinses den entstandenen wirtschaftlichen Verhältnissen des Mieters angepasst oder die Laufzeit des Schuldverhältnisses angemessen reduziert wird, könnte für den Mieter schon eine beachtliche Entlastung und einen Erfolg bedeuten.
Auf jeden Fall muss derjenige, der sich auf Störung der Geschäftsgrundlage gem. § 313 BGB beruft, die dafür maßgeblichen Tatsachen vortragen, ggf. auch Beweismittel vorlegen.
Es erscheint nicht abwegig, gerade auch bei bestimmten Fallen von Hochwasserschädigungen an den Weg der Nutzung des Rechtsinstituts der Störung der Geschäftsgrundlage gem. § 313 BGB zu denken.
Soweit die Mietsache (das betreffende Gebäude bzw. das Ladengeschäft) durch das Hochwasser völlig zerstört und unbrauchbar gemacht wurde, käme gem. § 275 BGB vom »Ausschluss der Leistungspflicht« - früher von der »Unmöglichkeit der Leistung« - in Betracht.
In einem solchen Fall des »Ausschlusses der Leistungspflicht« auf Grund des Hochwassers wird der Schuldner, also der Mieter, von seiner Verpflichtung zur Leistung, also zur Mietzahlung, frei. Es wird dann jedoch zwischen den Parteien ggf. Weitergehendes zu vereinbaren sein, so z. B. die auf übereinstimmenden Willen gegründete Beendigung des Mietverhältnisses oder möglicherweise ein Ruhen desselben, bis das Mietobjekt wieder nutzbar und vermietbar sein wird. Dabei sollte nicht vergessen werden, eine vom Mieter hingegebene Mietkaution zu berücksichtigen, ggf. zu verrechnen.
Kürzlich hat der BGH dieses Rechtsmittel des Wegfalls der Geschäftsgrundlage als ein außerordentliches Kündigungsrecht in einem Fall herangezogen, in dem der Nutzer - aus hier nicht weiter zu erörternden Gründen - zur Räumung und Herausgabe des von ihm genutzten Wochenendhauses verurteilt worden war.
Nach dieser Verurteilung gab es keine Grundlage mehr für eine Fortsetzung des Grundstücksnutzungsvertrages. Da eine Kündigung für diesen Fall weder im Gesetz noch im Vertrag vorgesehen war, fand der BGH den Weg über den »Wegfall der Geschäftsgrundlage« für adäquat.
(Wird fortgesetzt)