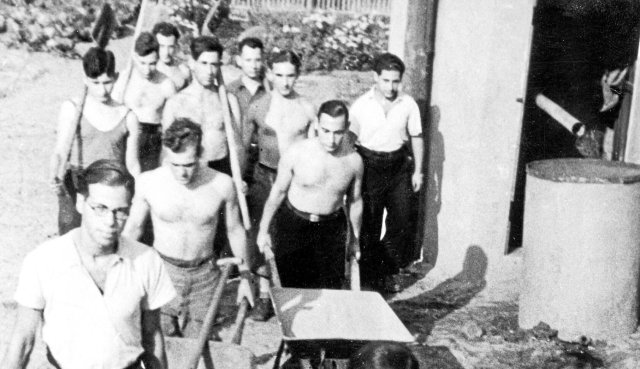Mikroskopische Pilze als Räuber
Mit Fangorganen werden die Opfer - meist Fadenwürmer - regelrecht erdrosselt Von DIETRICH ZIMMERMANN
Daß Pilze von zerfallendem organischen Material leben oder sich als Schmarotzer in den Stoffwechsel von Pflanzen und Tieren einklinken, ist allgemein bekannt. Doch es gibt auch eine ganze Reihe von Mikropilzen, die anderen Tieren Fallen stellen, sie fangen und als Nahrungsquelle nutzen. Eine Fähigkeit, die man vielleicht für die biologische Schädlingskontrolle in der Landwirtschaft nutzen könnte.
Erste Erfolge bei der Bekämpfung von Fadenwürmern oder Nematoden durch einen gezielten Einsatz von Mikropilzen konnten bereits erzielt werden, wie Annemarthe Rubner und Anne-Ruth Bernitzky in der Zeitschrift Biologie in unserer Zeit kürzlich berichteten. Beide Wissenschaftlerinnen hatten sich in ihren Forschungsarbeiten an der Freien Universität Berlin auf „nematophage“, also nematodenfressende Pilze spezialisiert.
Mittlerweile kennt man schätzungsweise 10 000 Arten von Fadenwürmern. Sie sind weltweit verbreitet, bewohnen nahezu alle Böden und kommen auch in Salz- und Süßwasser vor. Einige, so die Trichinen, können sogar dem Menschen überaus gefährlich werden, andere, in der Gruppe der „Älchen“ zusammengefaßt, sind gefürchtete Kulturpflanzenschädlinge und Insektenschmarotzer. Auch die auf den Nematodenfang speziali-
sierten Pilze sind praktisch in allen Böden anzutreffen, vorausgesetzt, diese sind feucht und bieten genügend Nahrung in Form verrotteter pflanzlicher Substanz.
Besonders eindrucksvoll ist die Fangmethode des Pilzes Arthrobotrys dactyloides. Er benutzt einen zusammenziehbaren Ring, der von einem der Fäden in den Raum gehalten wird, die das unterirdische Pilzgeflecht, das sogenannte Myzel, bilden. Wenn sich nun Nematoden über das Myzel schlängeln und dabei in solche Ringe geraten, werden sie schlagartig festgehalten. Innerhalb einer Zehntselsekunde vergrößert der an der Innenseite druckempfindliche Ring sein Volumen um das Dreifache und umschließt so den Wurm. Dieser kann sich nur in den seltensten Fällen wieder befreien, weil bereits unmittelbar nach der Umschlingung der Pilz damit beginnt, weitere Fäden ins Innere des Wurms
zu treiben. Wenn der eingefangene Fadenwurm bei seinen Befreiungsversuchen den Ring abreißt, hilft ihm das auch nicht, denn der Ring bleibt aktiv
Die Fangorgane anderer Mikropilze bestehen aus klebrigen'Netzwerken oder Fangknoten. Zwar zuckt der Fadenwurm bei der Berührung mit einem solchen Netzwerk zurück, doch verstrickt er sich dadurch nur noch stärker in seiner Falle. Da die Zellwand der Netze Lektine enthält, also eiweißhaltige Moleküle, die speziell Bindungen mit den Kohlehydraten in der Nematodenhaut eingehen, hat der Wurm auch in diesem Fall kaum eine Chance: Seine Oberfläche wird enzymatisch aufgelöst, so daß die Pilzfäden in seinen Körper eindringen können, um ihn auszusaugen.
Nach wie vor gibt es nur Vermutungen darüber, warum die Pilze überhaupt auf Nematodenjagd gehen - möglicherweise führt eine ausschließliche Kompost-Ernährung zu Mangelerscheinungen, vielleicht gibt es aber auch zuviele nichträuberische Nahrungskonkurrenten. Denkbar wäre sogar eine Schutzfunktion gegenüber Freßfeinden.
In der Landwirtschaft jedenfalls sind Raubpilze zur Kontrolle der schädlichen Nematoden mittlerweile unentbehrlich. Solange mit dem Stalldung regelmäßig organisches Material in den Boden eingebracht wurde, gediehen die Raubpilze soi gut, daß sicn“ die. Zahl*der Nematoden bis' zum Saatbeginn im Frühjahr in Schranken hielt. Doch die moderne Landwirtschaft verzichtet häufig auf die für die Regeneration des Bodens nötige Brache und verstärkt dafür die künstliche Düngung. Darunter aber leiden vor allem die Bodenpilze, während sich die Nematoden, begünstigt durch dichte Fruchtfolgen oder großflächige Monokulturen, massenhaft vermehren und nur durch enormen Chemikalieneinsatz unter Kontrolle zu halten sind.
In dem Bemühen, wieder bessere Bodenverhältnisse zu schaffen und die Düngemittelund Pestizidgaben zu verringern, wird in verschiedenen Laboratorien daran gearbeitet, Raubpilzkulturen so heranzuzüchten, daß sie als biologische Waffe gezielt gegen Nematoden wirken. Teilerfolge gab es bereits in Frankreich, wo erste Präparate in der Champignonzucht und im Tomatenanbau eingesetzt wurden.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.