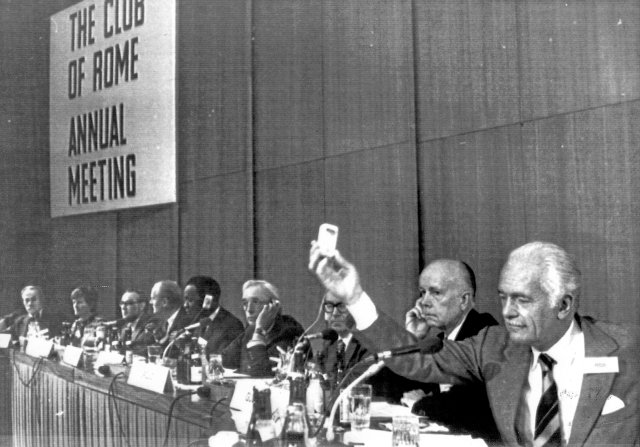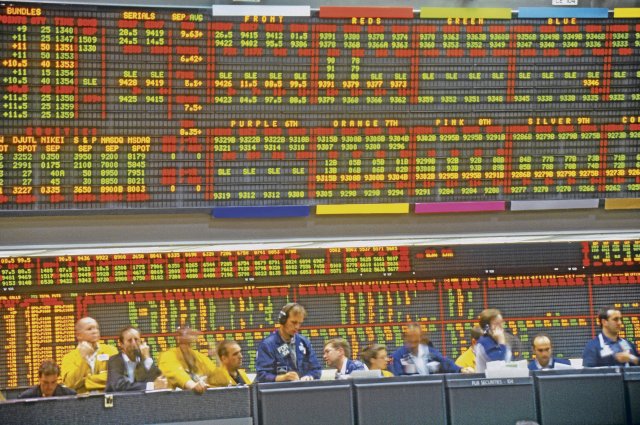Das Umwelt-Beispiel Japan – das jedoch keines ist
Reduzierungen der relativen ökologischen Belastung vom hohen Wirtschaftswachstum wieder aufgezehrt
Von MANFRED BINDER
Die Geschichte der Umweltpolitik ist in keinem Land der Welt so sehr von Extremen gekennzeichnet wie in Japan: Bis Ende der 60er Jahre wurde auf engstem Raum und in abenteuerlicher Geschwindigkeit eine der weltweit führenden Industrien aus dem Boden gestampft, mit einem Schwergewicht ausgerechnet auf schmutzintensiven Schwerindustrien wie Metallerzeugung und Chemischer Industrie. Auf Umwelt und menschliche Gesundheit wurde dabei lange Zeit kaum Rücksicht genommen, bis die Luftbelastung in den gigantischen Ballungsräumen für viele Menschen lebensgefährlich wurde.
Ausgehend von den Großstädten bahnte sich im Lauf der 60er Jahre eine radikale Kehrtwende an. Als dann in spektakulären Gerichtsentscheiden gesundheitlichen Opfern von Umweltverschmutzung Entschädigungen zugesprochen wurde, gewann Umweltpolitik auch auf nationaler Ebene endgültig oberste Priorität: Ein weitreichendes Entschädigungssystem für Er-
krankungen und Todesfälle durch Umweltbelastung wurde geschaffen, finanziert von den wichtigsten Verursachern. Vor allem aber gelang es innerhalb weniger Jahre, Japan zum ökologischen Vorbild unter den Industrienationen zu machen mit Hilfe fortschrittlicher Reinigungstechniken wie Rauchgasentschwefelungsanlagen und Katalysatoren für Kfz.
In anderen Ländern wurden diese, wenn überhaupt, erst zehn bis zwanzig Jahre später flächendeckend eingesetzt. Japan konnte dabei demonstrieren, daß auch vergleichsweise einschneidender Umweltschutz in keiner Weise die wirtschaftliche Entwicklung zu hemmen braucht. Mittlerweile hat sich in den Industrieländern der Charakter der für am drängendsten gehaltenen Umweltprobleme geändert: Konnte die Verschmutzung der Abgase durch Staub und Schwefeldioxid noch vergleichsweise effektiv durch zusätzliche Reinigungsanlagen vermindert werden, sind das Treibhausgas Kohlendioxid, der drohende Verkehrskollaps und die wachsenden Müllberge so nicht in den Griff zu bekommen. Hier
bedarf es einschneidender Maßnahmen, einer vorsorgenden Veränderung und nicht bloß einer umwelttechnischen Ergänzung von Produktion und Verbrauch. Die Industriegesellschaften müssen sparsamer werden in ihrem Verbrauch von Material, insbesondere von Energie, Wasser und nichterneuerbaren Rohstoffen, sie müssen sparsamer werden in ihrem Transportund in ihrem Flächenbedarf.
Kann von Japan auch in dieser Hinsicht gelernt werden? Tatsächlich haben Untersuchungen an der Forschungsstelle für Umweltpolitik gezeigt, daß die japanische Industrie in der Vergangenheit schon enorme Einsparpotentiale mobilisieren konnte. Zwischen Anfang der 70er und Mitte der 80er Jahre verdoppelte sich die Wertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes Japans, doch sein Verbrauch an Rohstoffen und Boden sowie das Gütertransportaufkommen stiegen nur unwesentlich, der Energieverbrauch sank sogar! Auch der seit Ende der 70er Jahre stagnierende industrielle Wasser- und Stromverbrauch wuchsen ins-
gesamt kaum halb so schnell wie die Wertschöpfung. Diese weitreichende Entkoppelung der Wirtschaftsleistung von der Umweltbelastung war hauptsächlich Resultat brancheninterner Modernisierungen: Ein (inflationsbereinigter) Yen wird heute mit sehr viel geringerem Ressourcenverbrauch erwirtschaftet als vor zwanzig Jahren, vor allem in den besonders belastenden Sektoren Chemie, Metall- und Papiererzeugung. Demgegenüber hatte der Bedeutungsverlust traditioneller Schwerindustrien wie Stahl-, Aluminiumund Zementerzeugung nur geringes Gewicht. Branchenkrisen waren'also genausowenig Hauptgrund der ökologischen Erfolge wie gezielte Auslagerungen von Produktionen ins Ausland.
Die Reduzierung der relativen Belastung entstand weitgehend ohne umweltpolitischen Druck. Zwar waren Anfang der 70er Jahre ökologische Belange in der Wirtschaftsstrukturplanung diskutiert, aber kaum je konkretisiert geschweige denn umgesetzt worden. Staatliche Politik war für diese Entwicklung,
wenn überhaupt, nur insofern mitverantwortlich, als von weniger umweltintensiven Industrien höhere Wettbewerbsfähigkeit und damit größerer Wohlstand erwartet wurde.
Doch trotz aller Modernisierungen hat die Belastung der Umwelt weiter zugenommen. Die im internationalen Vergleich beispiellosen relativen Einsparungen wurden aufgezehrt von den ebenso beispiellosen Wachstumsraten der Wirtschaftsleistung. Besonders gegen Ende der 80er Jahre kamen diese relativen Einsparungen zudem weitgehend zum Erliegen. Ohne sie hätten die wachstumsbedingten Umweltbelastungen leicht katastrophale Ausmaße annehmen können. Andererseits wären ohne das Wirtschaftswachstum die für die ökologischen Modernisierungen nötigen Investitionen vielleicht gar nicht finanzierbar gewesen. So beeindruckend also die Leistungen des Strukturwandels in Japan auch sein mögen - eine Perspektive für die Vereinbarkeit von Wirtschaftswachstum und dauerhafter Reduzierung der Umweltbelastung zeigten sie bislang nicht.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.