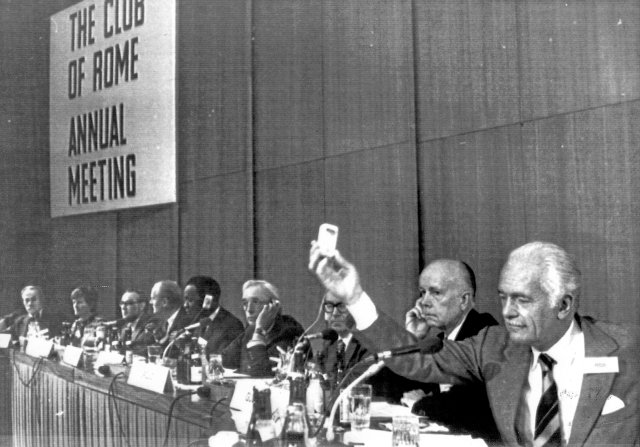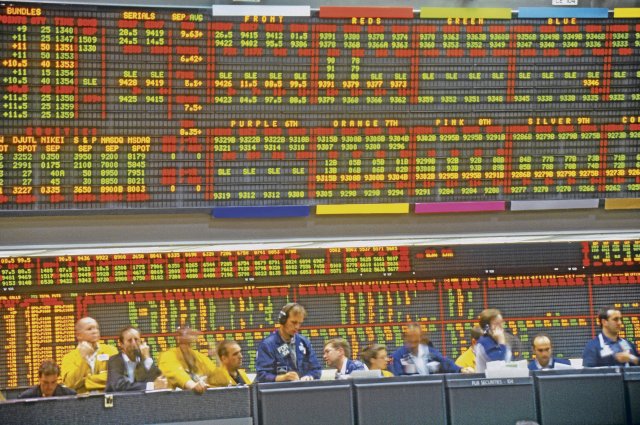Eine neudeutsche Frage: Kleingarten oder Datsche?
Grundeigentümer nicht mehr mit niedrigem Kleingartenpachtzins zufrieden / Anmerkungen zu einem Aufsatz
Nun gibt es auch Streit im Kleingartenwesen der neuen Bundesländer Zunehmend streiten Verpächter (Grundeigentümer) und Kleingärtnerorganisationen darüber, ob es sich bei den Kleingärten um solche im -Sinne des § 1 Bundeskleingartengesetz (BKleingG) handelt oder nicht. Hin brisantes Thema, da es Hunderttausende betrifft.
Der Streit wird regelmäßig von den Grundeigentümern begonnen. Deren Absicht ist eindeutig. Sie wollen den gegenwärtig noch relativ geringen Kleingartenpachtzins in den neuen Bundesländern nicht akzeptieren, sondern den weitaus höheren Pachtzins nach der Nutzungsentgeltverordnung durchsetzen und eine Einordnung ihrer Grundstücke als Kleinsiedlung oder Sondergebiet für Freizeit und Erholung fördern.
Die in diesbezüglichen Klagen der Grundeigentümer verwendeten Argumente finden sich zu großen Teilen in einem Aufsatz von Rechtsanwalt Gunnar Schnabel in „Das Hauseigentum“ (Nr. 5/94, S. 203/204) wieder. Wesentliche dieser Ausführungen halten jedoch einer näheren rechtlichen Betrachtung nicht stand.
Dem genannten Artikel ist zu entnehmen, daß nicht als Kleingärten gelte, wenn vom VKSK als Zwischenpächter an einzelne Nutzer Grundstücksflächen vertraglich überlassen wurden, aber keine planmäßige Ausgestaltung der Gesamtfläche als Kleingartenanlage mit einer Mehrzahl von Gemeinschaftseinrichtungen erfolgte und die Anzahl der Kleingärten weniger als 20 bis 50 Parzellen umfasse. Darüber hinaus solle die gesamte Anlage das Gepräge einer Kleingartenkolonie aufweisen.
Diese Forderungen entsprechen nicht dem Text des § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Bundeskleingartengesetzes, wo es heißt: „Ein Kleingarten ist ein Garten, der ... in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, zum Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereinshäusern, zusammengefaßt sind...“ Es müssen also nicht mehrere oder gar alle beispielhaft aufgeführten gemeinschaftlichen Einrichtungen vorhanden sein, um das Merkmal „Kleingartenanlage“ zu erfüllen. Nach vorherrschender Auffassung kann eine gemeinschaftliche Einrichtung genügen. Das ist zum Beispiel
der Fall, wenn die Einzelgärten lediglich durch Wege innerhalb der Anlage erschlossen sind.
Das „Gepräge“ der Kleingartenanlagen in den neuen Ländern unterscheidet sich von dem der Anlagen in den alten Bundesländern aufgrund der anderen historischen Entwicklung zum Teil erheblich:
1. In den neuen Bundesländern gibt es verhältnismäßig viel Kleingartenanlagen, die eine Größe von nur acht bis 20 Parzellen aufweisen. Dem liegt die Tatsache zugrunde, daß von den Räten und den LPG häufig nur kleine Flächen zur kleingärtnerischen Nutzung zur Verfügung gestellt wurden, zum Beispiel solche, die nicht als Acker oder Weide dienten. Kleingartenanlagen wurden aber auch überbaut. Dabei gelang es den Kleingärtnern oft nur, Restanlagen mit wenigen Parzellen zu retten. An dem Status „Kleingartenanlage“ änderte sich dadurch nichts. Entscheidend für die Größe der Anlage ist die örtliche Planung. Teilweise waren kleine Anlagen gerade staatlich gewollt.
Unstreitig ist eine Größe von 20 bis 150 Parzellen pro Anlage städteplanerisch günstig und somit anstrebenswert, ein zwingendes Kriterium für die
Eigenschaft „Kleingartenanlage“ ist sie jedoch nicht. Diese Auffassung wird von der Rechtssprechung gedeckt, wie Urteile der Amtsgerichte Freiberg (vom 11. Juni 1994, Az. 2 C 0293/94) und Potsdam (vom 19 Juli 1994, Az. 29 C 104/94, und 2. August 1994, Az. 29 C 105/94) beweisen.
2. Sanitäre Gemeinschaftsan : lagen wird man in den Kleingartenanlagen der neuen Bundesländer nur in Ausnahmefällen finden. Dazu bestand keine Notwendigkeit, da das Kleingarten- und Baurecht der ehemaligen DDR eine Erschließung der Lauben mit Wasser und Energie zuließ und demzufolge WC und Waschgelegenheit in der einzelnen Laube weit verbreitet waren und sind. Die örtliche Kleingartenplanung ließ auch Lauben über 24 qm Grundfläche zu, namentlich bei kinderreichen Familien. Demzufolge wird das „Gepräge“ der Kleingartenanlage in den neuen Bundesländern vielfach von größeren Lauben bestimmt. Sie genießen nach § 20a Nr. 7 des Bundeskleingartengesetzes Bestandsschutz. Allerdings müssen die betreffenden Kleingärtner dafür regelmäßig die Grundsteuer B entrichten.
3. In der DDR war es nicht untypisch, daß die Räte und LPG Einzelpachtverträge mit einer Vielzahl von Kleingärtnern schlössen, um die sinnvolle Nutzung gerade kleiner Flächen zu gewährleisten. Sie waren nur zum Teil im VKSK organisiert. Es lag im freien Willen der Nutzer, ob sie sich für eine Nutzung im Sinne der Gartenordnung des VKSK oder für reine Erholung entschieden. Für die Beurteilung der Eigenschaft „Kleingarten“ kommt es nur darauf an, ob die Art der Nutzung am 3. Oktober 1990 dem Bundeskleingartengesetz entsprach.
Die planmäßige Gestaltung der Kleingartenanlage war in der DDR der Normalfall. Andere Anlagen haben sich jedoch über mehrere Jahre entwickelt, ohne daß von Anfang an ein Plan dafür bestand. Dieser Entwicklungsprozeß mußte auch nicht spätestens am 2. Oktober 1990 abgeschlossen sein. Ist das Grundstück nach Ablauf des 2. Oktober 1990 in eine Kleingartenanlage eingegliedert worden, müssen von da an die Bestimmungen des Bundeskleingartengesetzes angewendet werden.
Dr UWE KARSTEN
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.