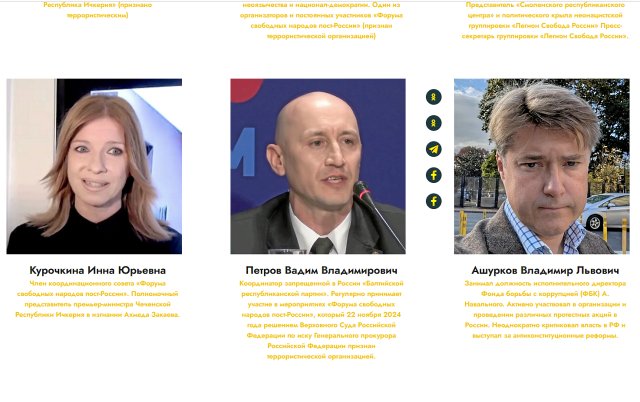»Wir wollen eine föderale Ukraine«
LINKE-Politiker solidarisieren sich mit KPU
Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei der Ukraine (KPU), Petro Simonenko, kann sich nach eigenen Angaben nicht mehr sicher in der Hauptstadt Kiew bewegen. Bei einem Pressegespräch in Berlin berichtete Simonenko, dass sein Auto Mitte dieses Monats mitten in der Stadt gestoppt worden sei, Unbekannte die Scheiben eingeschlagen und einen Molotowcocktail ins Innere des Fahrzeugs geworfen hätten. Schlimmeres sei verhindert worden, weil die Brandflasche nicht explodierte und seine Begleiter sie aus dem Auto werfen konnten.
Simonenko war auf Einladung von Politikern der LINKEN in der Bundeshauptstadt, um seine Sicht der Ereignisse in seiner Heimat zu schildern. An dem Gespräch nahmen auch die Bundestagsabgeordneten Wolfgang Gehrcke, Alexander Neu, Sevim Dagdelen und Parteivize Tobias Pflüger teil. »Wir brauchen Solidarität mit antifaschistischen Kräften in der Ukraine«, sagte Pflüger. Die Bundesregierung forderte er auf, sich mit den Ursachen für die Proteste in der Ostukraine auseinanderzusetzen. Gehrcke sprach auch von einer »sozialen Frage«.
Die ukrainische KP hatte bei den Parlamentswahlen im Jahre 2012 13,2 Prozent der Stimmen erhalten und stellt 32 von 450 Abgeordneten. Dagegen hatte sie bei der Präsidentschaftswahl, die der Oligarch Petro Poroschenko gewann, keine Chance. Das lag auch daran, dass in Regionen, in denen die Kommunisten Stammwähler haben, eine geregelte Wahl nicht möglich war. Die Krim hat sich von der Ukraine abgespalten und sieht sich als Teil Russlands. Der Osten ist umkämpft. Seine Beteiligung hatte Simonenko kurz vor der Wahl zurückgezogen.
Simonenko forderte eine Föderalisierung des Landes, ein Ende der Kämpfe und einen Runden Tisch, an dem sich alle beteiligen sollen. Die Regierung bezeichnete Simonenko als »national-faschistisches Regime«. Poroschenko sei Teil dieses Regimes. Der Oligarch sei als Vertreter des Großkapitals und Unterstützer der Maidan-Bewegung am Aufstieg der rechtsextremen Regierungspartei Swoboda beteiligt gewesen.
Parteibüros der KPU waren in den vergangenen Monaten verwüstet und in Brand gesetzt worden. Nun droht den Kommunisten ein Parteiverbot. Mehrere Organisationen haben beim Generalstaatsanwalt einen Antrag eingereicht. Angeblich soll die KPU russische Separatisten unterstützen und mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeiten. Die KPU war von 1991 bis 2001 verboten, gründete sich aber 1993 neu. Simonenko erinnerte daran, dass das Verbot 2001 für unrechtmäßig erklärt worden war.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.