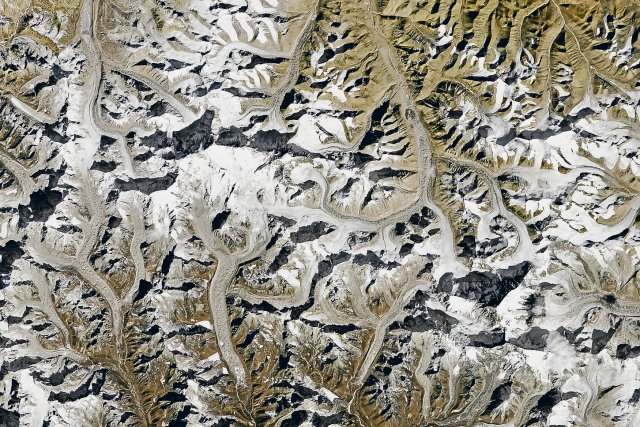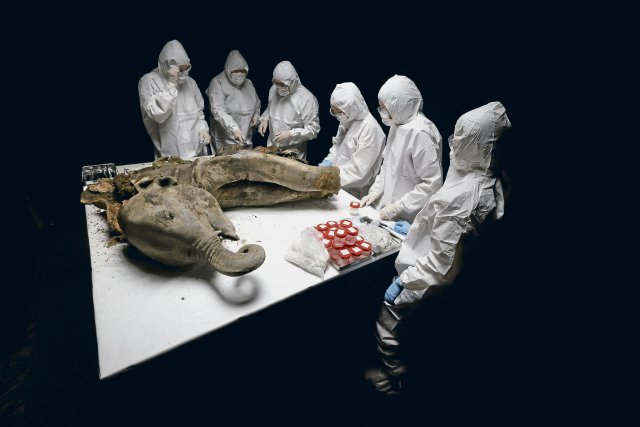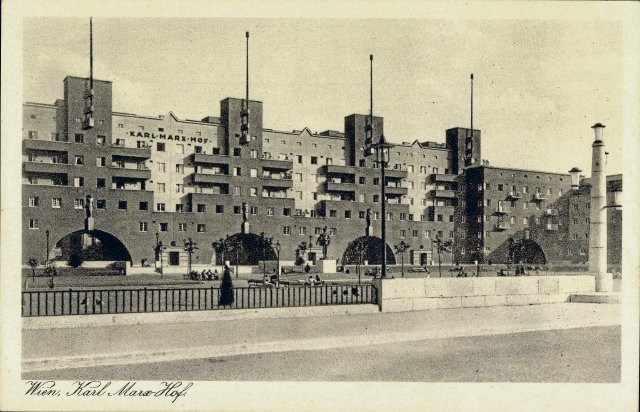Nicht das Ende der Welt
Nicht immer ist ein abgebrochenes Studium Ausdruck des Scheiterns
Studienabbrecher nicht häufiger arbeitslos
Doch nicht jedem, der sein Studium abbricht, ergeht es wie Mick Jagger, Bill Gates oder Steven Spielberg. Und doch ist eines typisch am Karriereverlauf von Studienabbrechern am Beispiel der erfolgreichen Drei: Studenten brechen in der Regel ihr Studium nicht ins Leere ab, sie beenden das Studium erst, wenn sich eine Alternative auftut, die sie als vorteilhafter als das Studium selbst erachten. Folglich beenden Studenten in Deutschland ihr Studium relativ spät, im Durchschnitt nach siebeneinhalb Hochschulsemestern, und die häufigsten Tätigkeitsformen von Studienabbrechern nach dem Studium sind »die Aufnahme einer Berufstätigkeit oder auch die Aufnahme einer Ausbildung«, so Ulrich Heublein, Mitverfasser der »Studienabbruchstudie 2005« von der Universität Leipzig.
Große Vielfalt, immer mehr Studenten an den Unis, die Zahl der Studierenden hat sich in den letzten 30 Jahren von knapp 850 000 aus dem Jahre 1975 auf bis zu zwei Millionen Studierende im Jahr 2004 mehr als verdoppelt. Führt das zu immer mehr Orientierungslosigkeit unter den Studierenden? Dazu gibt es keine genauen Zahlen, genauso wenig lässt sich eine genaue Studienabbruchsquote für die letzten Jahrzehnte quantifizieren. Dennoch zeigt sich, dass sich die Studienabbrüche im Vergleich zu den 70er Jahren bis heute anteilig fast verdoppelt haben, das sind jedoch grobe Schätzwerte. Seit den letzten Jahren sind die Abbruchzahlen aber nicht sonderlich angestiegen, insgesamt verlassen heute 25 Prozent von 100 Studienanfängern die Hochschule ohne Abschluss, gemessen an denjenigen, die Mitte der 90er Jahre ihr Studium angefangen haben. Ulrich Heublein vermutet sogar, dass die Abbruchsquote jüngst wieder etwas abnimmt.
Warum aber überhaupt abbrechen, wenn es doch Schlimmeres gibt als ein lästiges bis stressiges Studium? In der Regel kommen mehrere Motive zusammen, wenn sich Studenten zur Exmatrikulation entscheiden. Die häufigsten Gründe sind berufliche Umorientierungen, auch Probleme mit der Studienfinanzierung, fehlende Studienmotivation und Fachidentifikation oder auch Leistungs- und/oder Familienprobleme sowie von weiblicher Seite auch die Nichtvereinbarkeit von Studium und Kinderbetreuung. Im Fächervergleich zeigt sich dann: Die höchsten Abbruchsquoten sind bei den Sprach- und Kulturwissenschaften sowie bei sportwissenschaftlichen Studiengängen mit jeweils 35 Prozent auszumachen. Gerade hier ergeben sich aufgrund der großen Gestaltungsspielräume durch die sehr offenen und unstrukturierten Studiengänge Orientierungsprobleme. Auch haben viele Studienanfänger schon vor der Einschreibung wenig Klarheit über die eigentlichen Studieninhalte und Studienanforderungen, so herrscht beim engeren Studienbereich der Sprach- und Kulturwissenschaften sogar mit 45 Prozent die höchste Abbruchquote aller Studienbereiche. Und ein Vergleich verschiedener Fächergruppen ergibt: Bei Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften beträgt die Studienabbruchquote 29 Prozent, bei Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 28, bei Mathematik und Naturwissenschaften 26, bei Medizin 11 und bei den Lehrämtern 12 Prozent.
Auch Florian Breithaupt aus Berlin ist ein »erfolgreicher« Studienabbrecher, er studierte Lehramt, doch irgendwie konnte er sich nie an den Gedanken gewöhnen, einmal als Lehrer zu arbeiten. Breithaupt orientierte sich darum während des Studiums beruflich um, wollte in den journalistischen Bereich, machte Praktika und ist heute Redakteur beim Fernsehen. »Ich hatte Glück, ich bekam einen Volontariatsplatz angeboten, warum soll ich das ablehnen?«
Ja warum nur? Immerhin sind Studienabbrecher ein halbes Jahr nach ihrer Exmatrikulation nicht zu einem wesentlich höheren Anteil arbeitslos als Absolventen ein halbes Jahr nach Studienende, ihr Anteil liegt bei etwa 10 Prozent - und das in allen Fächergruppen. Und wer im Werk der Autorinnen Christine Öttl und Gitte Härter »Studienabbruch, na und!« ein wenig blättert, der kann durchaus motiviert sein, achselzuckend und ohne große Zukunftsangst die Studienakte zu schließen, die Uni folglich ohne ein Zertifikat in der Tasche zu verlassen. Denn, so Öttl und Härter, viele Unternehmen schauten heute keineswegs nur auf Abschlüsse und Noten. Die Persönlichkeit sei vielmehr wichtiger, und fachliche Defizite ließen sich auch leichter als persönliche ausgleichen.
Netzwerke schützen vor Arbeitslosigkeit
Dabei gibt es jedoch keine genauen Erkenntnisse darüber, was zwei, drei oder mehr Jahre nach dem Abbruch des Studiums passiert, wie sich die Karriereverläufe dann entwickeln. Klar ist dennoch, dass Studenten bereits während des Studiums lernen, oder es zumindest lernen sollten, sich selbst zu organisieren, Kontakte zu knüpfen, die es ihnen dann ermöglichen, sich vor Arbeitslosigkeit weitestgehend zu schützen. Die französischen Soziologen Luc Boltanski und Eve Chiapello haben in ihrem Werk »Der neue Geist des Kapitalismus« treffend beschrieben, dass es heute weniger ein Unten und Oben gemessen an Klassenstrukturen gibt, vielmehr ein Drinnen und Draußen, drinnen ist dann der, wer den neuen Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt standhalten kann. Sprich: wer vernetzt ist, mobil und flexibel agiert. Die neuen »sozialen Ausgegrenzten« kann man darum heute in sämtlichen Berufssparten finden.
Das Zauberwort der heutigen Zeit heißt Netzwerkpflege, und das betreiben Studierende schon frühzeitig, sie versuchen schon während des Studiums ein Bein in die Tür zur Berufswelt zu bekommen. Viele Studenten geben darum auch schon während des Studiums nach, beenden alles und versuchen ihr Glück einfach auch ohne Abschluss.
In zwei Wochen: Viele Hochschulabsolventen mit Diplom in der Tasche fürchten sich vor Arbeitslosigkeit und hängen darum noch ein Studium dran. Aber lohnt sich das?
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.