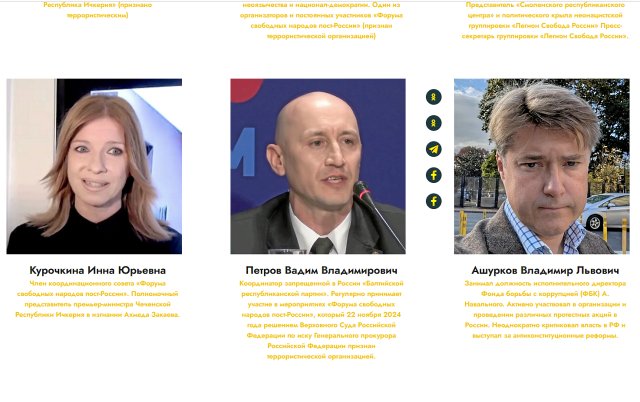Es geht wieder bergab am Tempelberg
Konfrontationen in Ostjerusalem heizen die israelisch-palästinensischen Spannungen an
Vor dem Damaskustor in der Altstadt von Ostjerusalem haben sich am Freitagmittag Hunderte junge Männer zu einem improvisierten Freitagsgebet versammelt. Einige Schritte weiter versperren Polizisten den Weg zum Haram al-Scharif, der bei Juden und Christen als Tempelberg bekannt ist.
Die Straße hinauf sind Hunderte auf dem Weg zur Klagemauer, auch hier unter strenger Bewachung der Polizei. Denn die Stimmung ist auf beiden Seiten gespannt, aggressiv. Wie aggressiv, das lässt sich an diesem Freitag in rechtsgerichteten israelischen und palästinensischen Internetforen nachlesen: Offen werden dort die Gewaltabsichten dargelegt, werden Pläne geschmiedet.
Denn am Mittwochabend wurde versucht, den Rabbiner Jehuda Glick zu erschießen; für den rechten Rand der israelischen Rechten kommt dies einer Kriegserklärung gleich. Glick ist eine der Schlüsselfiguren der Tempelberg-Bewegung. Unermüdlich tritt er nicht nur dafür ein, dass Juden auf dem Haram al-Scharif beten dürfen. Er fordert auch vehement den Bau des »Dritten Tempels« an diesem Ort.
Große Bedeutung hatte die Tempelberg-Bewegung bislang nicht, auch in der rechten Szene wird sie für eher realitätsfern gehalten. Dass Glick nun zum Ziel eines Attentats wurde, hat ihn für die Ultrarechten zum Symbol gemacht. Der Angriff auf ihn wird von ihnen als Angriff gegen den israelischen Anspruch auf den Tempelberg gesehen - während junge Sympathisanten von Hamas und Islamischem Dschihad Glicks Arbeit als Attacke gegen die drittheiligste Stätte des Islam sehen und das Attentat als »Verteidigung« rechtfertigen. Dass ein Sonderkommando der israelischen Polizei am Donnerstag einen 32-jährigen Verdächtigen erschoss und die Regierung dann die komplette Schließung der heiligen Stätte anordnete, heizte ihre Wut weiter an.
Es war das erste Mal seit den Ausschreitungen nach dem Besuch Ariel Scharons auf dem Haram al-Scharif im Jahr 2000, dass die Anlage komplett gesperrt wurde. Bei der Verwaltung der heiligen Stätte sagt man sogar, es sei das erste Mal gewesen, seit Israel 1967 Ostjerusalem besetzte. Aus Sicht der Regierung wollte man verhindern, dass Israelis und Palästinenser aufeinander losgehen.
Denn rechte israelische Politiker hatten am Donnerstag zu einem Marsch auf den Tempelberg aufgerufen; im Internet hatten Jugendliche geplant, die Anlage an diesem Freitag zu stürmen. Und Fatah und Hamas hatten, unabhängig voneinander, die Palästinenser zu einem »Tag des Zorns« aufgerufen.
Die Schließung der Anlage sorgte allerdings für heftige Kritik in der internationalen Gemeinschaft, in der Israels Regierung seit dem Gaza-Krieg ohnehin schon einen schwierigen Stand hat; Jordanien drohte mit Abbruch der Beziehungen. Denn im Friedensvertrag zwischen beiden Ländern ist geregelt, dass Amman die muslimischen Stätten in Ostjerusalem verwaltet und Israel den freien Zugang dorthin garantiert.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.