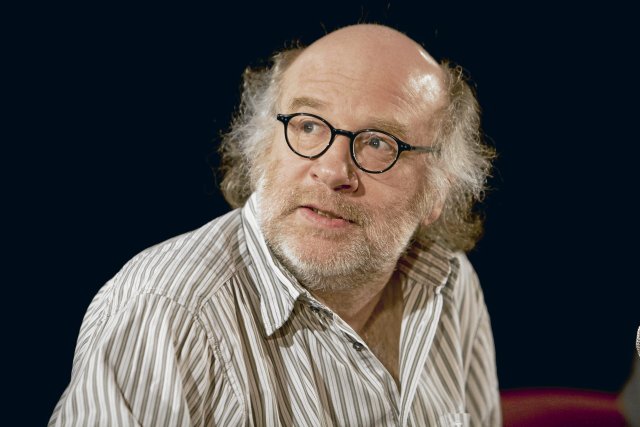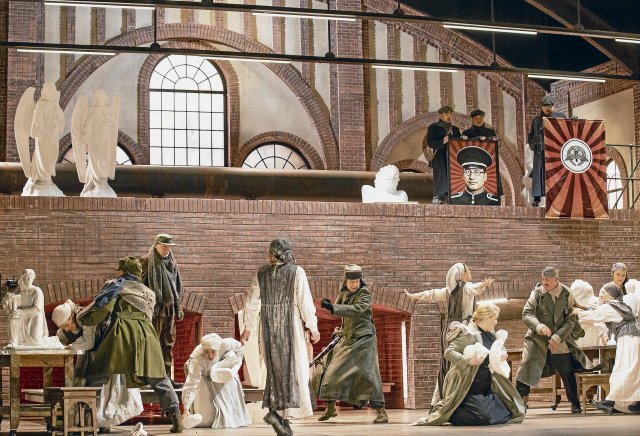- Kultur
- Buchmesse Leipzig
Pau und das Bild von ihr
Anekdoten aus dem Politikerleben einer Vizepräsidentin des Bundestags
Es gibt nicht viele Politiker der Linkspartei, die auf eine mehr als 16 Jahre lange, ununterbrochene Karriere als Bundestagsabgeordnete zurückblicken können. Um genau zu sein: Es gibt nur zwei. Eine davon heißt Petra Pau und wenn Menschen gefragt werden, ob sie die Vizepräsidentin des Parlaments kennen, fällt ihnen meist die Frisur ein. Von Pau hat sich durchaus mehr eingegraben ins öffentliche Gedächtnis als der Rotschopf. Davon, wie solche Bilder entstehen, wie sie manchmal auch zugerichtet werden aus Interesse, davon handelt das kleine Bändchen mit anekdotischen Erinnerungen an ihre bisherige Politiklaufbahn: »Gottlose Type«.
Buch im nd-Shop bestellen:
* Petra Pau: Gottlose Type. Meine unfrisierten Erinnerungen.
Eulenspiegel. 142 S., geb., 9,99 €.
Nein, das ist kein Buch mit einem religionskritischen Anspruch. Es ist darin nicht einmal so viel von Kirche die Rede, obgleich Pau getauft und konfirmiert ist und in der DDR einen evangelischen Kindergarten in Lichtenberg besucht hat. Die »gottlose Type« ist keine Selbstbeschreibung, sie gehört zu den Rastern, die andere schufen - und in die eine Politikerin wie Pau dann gern und kurzerhand eingepasst wird. Zum Beispiel bei der Abstimmung über die Hartz-Reformen Ende 2003, als Pau und ihre damalige PDS-Kollegin Gesine Lötzsch eine Verschiebung der Abstimmung über das in jeder Hinsicht große Gesetzeswerk beantragten - was zu einer Sondersitzung kurz vor Weihnachten hätte führen können. Und was dem CSU-Politiker Peter Ramsauer nicht gefiel, weshalb er Pau als »gottlose Type« beschimpfte.
Ramsauer ist sicher nicht der einzige, der sich einfach nicht vorstellen konnte, dass jemand aus dem Osten nicht nur ein paar kirchliche Stationen in seiner Biografie aufweist, sondern dann auch noch in der PDS landet. Es sind solche Vereinfachungen, Zerrbilder, die Pau in diesem Büchlein einer Art persönlicher Aufarbeitung durch Erinnerung, durch Erzählung unterzieht. Meist sind es Geschichten, die von dem Unwillen künden, sich so etwas wie eine demokratische Sozialistin, so etwas wie einen Menschen, der zur Selbstkritik seiner Biografie fähig ist, der dafür auch politischen Ärger erträgt, überhaupt vorzustellen.
Ganz am Schluss schreibt Pau, sie sei jahrelang in Funk und Fernsehen immer dann gefragt worden, wenn es rückblickend um die DDR ging. Wobei die Formulierung »gefragt« hier etwas in die Irre führt, denn fragen klingt nach einem wahrhaftigen Interesse an Antworten. Pau aber schildert, wie sie mehr als einmal zum Abziehbild einer vorgefertigten Meinung wurde, zum Standbild, das die unbezweifelbaren Schattenseiten der DDR bloß noch illustrierte - statt eine Auseinandersetzung damit zu suchen, die diesen Namen auch verdient.
Das ist nicht nur eine geschichtspolitische Frage. Wer Paus Buch gelesen hat, weiß, dass das auch eine ganz persönliche Frage ist. Eine, die sehr tief gehen kann. Einmal, es war Mitte der 1990er Jahre und der erste Auftritt der Politikerin in einer Fernsehtalkshow, keulte der CSU-Politiker Michael Glos unvermutet gegen Pau und deren Eltern: diese seien »rotlackierte Faschisten«.
Der LINKE-Politikerin verschlug es damals die Sprache. Das ist ehrlich, wie sie von der inneren Erschütterung erzählt. Und zugleich zurückhaltend, weil man daraus auch eine große Pose hätte machen können. Pau beschränkt sich auf den Hinweis, Glos ein paar Jahre später wiedergesehen zu haben: abermals in einer Talkshow. Bevor der sich nicht öffentlich bei ihr entschuldige, habe sie ihm bei der Gelegenheit gesagt, »rede ich mit Ihnen kein Wort«.
Glos hatte seine Diffamierung vergessen. Er hatte vielleicht auch gar nicht zu Petra Pau gesprochen, sondern zu dem Bild, das andere von ihr gezeichnet hatten. Nun hatte der Mensch Pau ihm geantwortet. Glos »rang um Worte und fand sie lange nicht«.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.