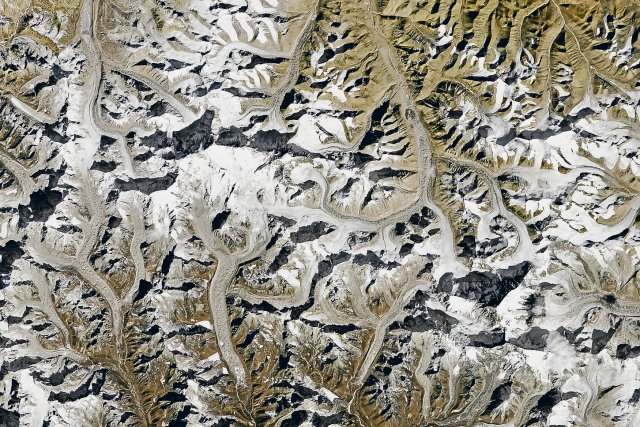Bakterientrick für den Menschen
Neues Verfahren erleichtert präzise Genveränderung, doch seine Anwendung bei menschlichen Embryonen sorgt für Unruhe. Von Steffen Schmidt
Viele Krankheiten haben ihren Ursprung in einem genetischen Defekt - seien es ererbte Risiken wie bei der Huntington-Krankheit und der Mukoviszidose oder aber Defekte einzelner Zellen wie bei Krebs. Anfang der 1990er Jahre versuchte man erstmals, solche Defekte mit gentechnischen Mitteln zu beheben. Doch obwohl weltweit viele Forschungsgruppen auf diesem Gebiet aktiv wurden, blieben Erfolge aus. Schlimmer noch, 1999 verstarb bei einer klinischen Studie ausgerechnet einer der gesunden Vergleichsprobanden. Die Todesursache verweist zugleich auf ein zentrales Problem der bisherigen Gentherapietechniken: Um das korrigierte Erbgut in die Zellen des Patienten zu bekommen, war bisher immer ein Transportvehikel notwendig. Und als effektivste Transporteure erwiesen sich Viren, die ja auch in freier Wildbahn genau das tun, was hier gefragt ist: Kleine Schnipsel des Erbgutmoleküls DNA in lebende Zellen zu bringen und sie dort ihre Informationen ablesen zu lassen. Und ausgerechnet auf das verwendete Transportvirus, das mit den normalen Erkältungsviren verwandt ist, reagierte das Immunsystem des Probanden so verheerend. Seit diesem Unfall war es ziemlich still geworden um die Gentherapie.
Da auch bei der Umprogrammierung von Körper- zu Stammzellen Viren eingesetzt wurden, sah man auch da zu viele Risiken, um sie außerhalb des Labors einzusetzen.
Das könnte sich nun ändern. Denn ein erst vor knapp drei Jahren entwickeltes Verfahren scheint gleich mehrere der bisherigen Hindernisse zu beseitigen. Es hört auf den reichlich sperrigen Namen CRISPR-CAS9. Dahinter verbergen sich zwei kleine Moleküle aus dem Bakterium Streptococcus pyogenes, die dort für die Abwehr von Bakteriophagen sorgen. Hat das Bakterium einen Angriff eines solchen spezialisierten Virus überlebt, dann produziert es mit dem Erbmolekül RNA einen »Fingerabdruck« eines Schnipsels aus dem Phagen-Genom. Bei einem neuerlichen Angriff tastet das CRISPR-Molekül das Phagengenom ab, bis es an einen zum RNA-Abdruck passenden Genabschnitt kommt. An dieser Stelle zerschneidet dann das Enzym CAS9 gewissermaßen als Schere das Erbgut des Angreifers und macht es so unbrauchbar.
Im Sommer 2012 veröffentlichten Jennifer A. Doudna von der University of California in Berkeley und Emmanuelle Charpentier, damals an der schwedischen Uni Umeå, im Fachjournal »Science« eine Arbeit, die zeigte, wie man diesen Selbstverteidigungsmechanismus von Bakterien zur gezielten Genveränderung in höheren Organismen verwenden kann. Die Französin Charpentier, die inzwischen am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig arbeitet, hatte nämlich herausgefunden, dass die CRISPR-CAS9-Moleküle erst mit einem zweiten RNA-Stück gemeinsam zuschlagen.
Danach kommen dann die zelleigenen DNA-Reparaturmechanismen ins Spiel. Der einfachere schließt an der Stelle, wo ein Abschnitt herausgenommen wurde, einfach wieder die DNA-Molekülkette, der kompliziertere setzt an dieser Stelle das passende Genmaterial wieder ein. Während der erste Weg für das Ausschalten unerwünschter Gene taugt, können über den zweiten Gene korrigiert werden.
Das Verfahren ist relativ schnell. Der Genforscher Klaus Rajewsky vom Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin-Buch sagt dazu: »Wofür früher Jahre benötigt wurden, genügen jetzt Monate.« Überdies ist es recht kostengünstig, und verschiedene Firmen bieten bereits fertige CRISPR-CAS9-Reagenzien an. Charpentier meint deshalb, das von ihr mitentwickelte Verfahren sei »das Schweizer Taschenmesser der Gentechnik«.
Soweit klingt es, als sei hier der lang erwartete Durchbruch auch für die Gentherapien erreicht. Zumal bei diesem Verfahren die umstrittenen Viren als Transportmittel in die Zelle nicht mehr vonnöten sind.
Doch kürzlich sorgte ein chinesisches Forscherteam von der Sun-Yat-sen-Universität in Guangzhou für Schlagzeilen, als es die neue Technik einsetzte, um in Embryonen das für die Blutkrankheit Beta-Thalassämie verantwortliche Gen zu korrigieren. Die verwendeten Embryonen stammten aus Kinderwunschkliniken und wären dort wegen eines überzähligen Chromosomensatzes ohnehin zerstört worden. Die therapeutische Genveränderung in menschlichen Embryonen, Samen- und Eizellen - die sogenannte Keimbahntherapie - ist in rund 40 Ländern verboten. Und selbst in den gentechnikfreundlichen USA riefen viele namhafte Genforscher dazu auf, für derartige Anwendungen erst einmal ein internationales Moratorium durchzusetzen. Gegenüber »nd« sprach sich auch Emmanuelle Charpentier dafür aus: »Ich glaube, im Moment ist die Keimbahntechnik entbehrlich. Es gibt einfach zu viele unbeantwortete Fragen.«
Die Versuchsergebnisse des chinesischen Teams sind selbst ein Beleg für die vielen offenen Fragen. Denn letztlich war ihr Unternehmen ein Misserfolg. Von 86 behandelten Embryonen wurde nur in 28 der gewünschte Genabschnitt aktiv und auch da nicht in allen Zellen. Zu allem Übel gab es neben der erwünschten Genveränderung noch unerwartet viele weitere Mutationen. Das Team um Junjiu Huang brach das Experiment deshalb ab und räumte ein, dass die Technologie offenbar noch nicht reif für die Keimbahntherapie ist.
Dennoch sind keineswegs alle Forscher gegen den chinesischen Vorstoß. So wird der britische Bioethiker John Harris von der University of Manchester im Fachblatt »Nature« zitiert, die Versuche seien auch nicht schlimmer, als wenn die fehlerhaften Embryos in der Klinik gleich weggeworfen worden wären. Es bleibt ohnehin offen, wie weit ein Moratorium für derartige Versuche weltweit durchsetzbar wäre.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.