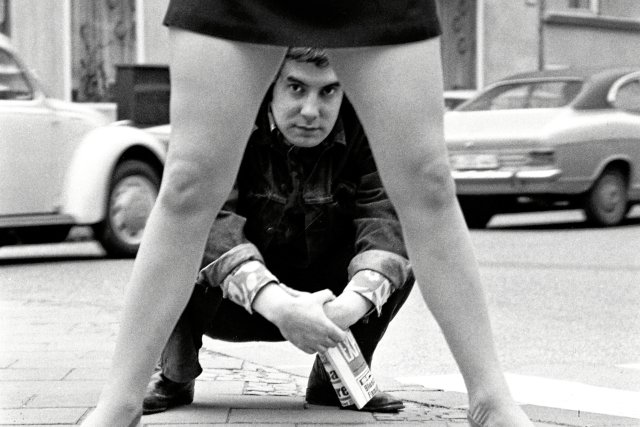Millionenlücken in der Abschlussbilanz
Treuhand und Parteienkommission entwickelten im Umgang mit Parteien aus der Ex-DDR unterschiedliche Maßstäbe
Anfang 1990, als viele DDR-Bürger noch glaubten, es gehe um eine erneuerte sozialistische Republik, lief im Hintergrund schon das Unternehmen Übernahme. Die großen Parteien der Bundesrepublik hatten längst ihre Fühler nach Osten ausgestreckt. Berater aus dem Westen zogen die Fäden, pumpten Geld in den politischen Umbruch Ost. Es lockten Einfluss und Pfründe. Die jahrzehntelang der SED ergebenen Blockparteien CDU und DBD (Bauernpartei) schwenkten zügig zur West-CDU, die Liberalen von der LDPD und die NDPD in Richtung FDP.
Der Einsatz im Osten hatte für CDU und FDP auch ganz materielle Gründe: Sie spekulierten auf Hunderttausende neue Mitglieder und auf Parteieigentum in Gestalt von Geld, Gebäuden und Zeitungsverlagen. Um dessen rechtmäßigen Erwerb zu klären, wurde 1990, noch zu DDR-Zeiten, die Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen eingesetzt. In ihrem Auftrag sollte die Treuhandanstalt die Vermögenswerte vorübergehend verwalten.
Nach der deutschen Vereinigung um etliche Beamte und Politiker aus dem Westen aufgestockt, entwickelten die beiden Gremien bald unterschiedliche Maßstäbe für ihre Arbeit. Die PDS wurde als Rechtsnachfolgerin der SED buchhalterisch so hart an die Kandare genommen, dass sie sich in ihrer politischen Arbeit drastisch eingeschränkt sah. Die Kontrolleure verstiegen sich teils zu abenteuerlichen Behauptungen - etwa zu der These, mehr als zwei Millionen Mitglieder könnten gar nicht freiwillig in der SED gewesen sein, weshalb ein Großteil der Mitgliedsbeiträge der Partei nicht zustünde.
Mit Sicherheit war es extrem schwierig, Licht in das Vermögensimperium der SED zu bringen. Die teils verdeckten wirtschaftlichen Verflechtungen reichten auch ins Ausland; PDS-Chef Gregor Gysi konstatierte seinerzeit: »Die SED ist zum Teil wie eine illegale Partei betrieben worden.« Der eine oder andere PDS-Funktionär entwickelte kriminelle Energie, um Parteivermögen im Ausland zu bunkern - als Vorsorge für die Zeit einer vermeintlich drohenden Illegalität. Letztlich blieben der PDS vier Immobilien sowie das »Neue Deutschland« und der Karl-Dietz-Verlag.
Dagegen waren die staatlichen Kontrolleure bei den einstigen Blockparteien wesentlich großzügiger. Zwar konnten sie bei weitem nicht mit Größe und Vermögen der SED mithalten, eine gute Partie waren sie dennoch. Und das nutzten die Westpaten genüsslich aus. Als die Parteienkommission 1996 ihren Abschlussbericht vorlegte, klafften in der CDU-Bilanz Millionenlücken. Das scherte allerdings niemanden, ebenso wenig wie die Tatsache, dass sich die CDU-Landesverbände Ost bis zum Beitritt zur Westpartei auf Null gerechnet hatten. Und die »FAZ« durfte die Verlagsgruppe der Ost-CDU für lächerliche vier Millionen D-Mark kaufen; allein die zugehörigen Grundstücke wurden wenig später auf das Zehnfache taxiert.
Ähnlich rührend kümmerten sich Treuhand und Parteienkommission um die Liberalen. Zwar hatte die FDP nach Ansicht der Kommission keinen Anspruch auf das Vermögen von LDPD und NDPD, weil deren Anschluss juristisch fehlerhaft abgelaufen war. Aber 1995 schloss man einen netten Vergleich mit der FDP: Sie durfte gut 20 Millionen D-Mark aus Ostvermögen behalten und bekam auch noch zwei Grundstücke. Ganz genau konnte man die Sache leider nicht prüfen, denn weil die beiden Ostparteien ihr Vermögen schnell genug der Westpartei überlassen hatten, konnte laut Kommission darüber »nicht mehr uneingeschränkt berichtet werden«. Übrigens hat die FDP ihre Mitgliederzahl durch den Zuwachs Ost verdreifacht. Sie brauchte keine zehn Jahre, um auf das alte Maß zurückzuschrumpfen. Wolfgang Hübner
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.