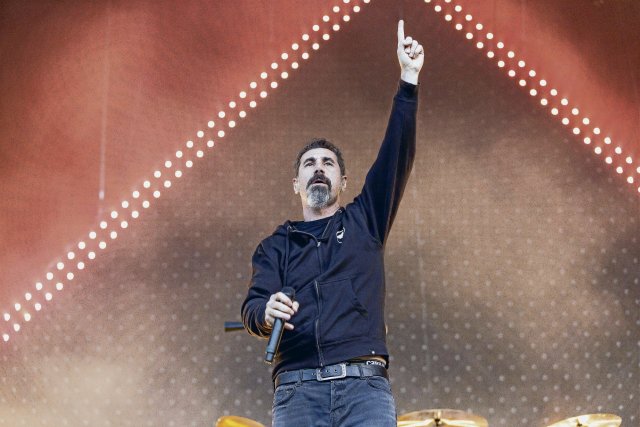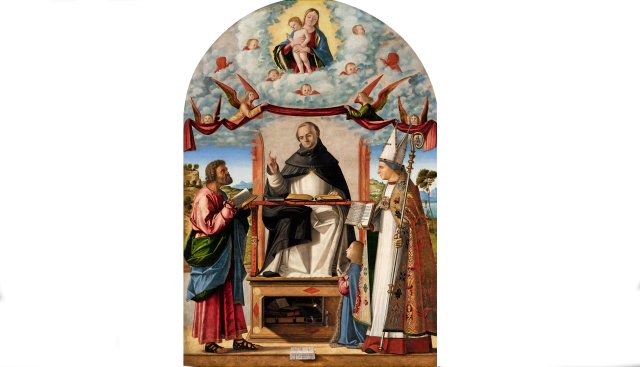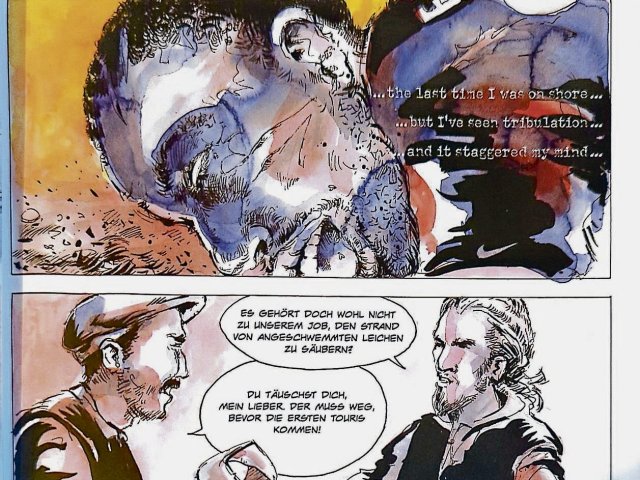Vanilla-Mezzanine-RMBS-CDO?
John Lanchester erklärt die Sprache des Geldes
Mit seinem 700-seitigen fulminanten Krisenroman »Kapital« machte der britische Schriftsteller John Lanchester vor drei Jahren Furore. Mittlerweile ist das Buch über die Bewohner einer Londoner Straße im Jahr 2007 zum internationalen Bestseller avanciert. Nun hat Lanchester die umfangreichen Recherchen für seinen Roman ausgeschlachtet und ein Sachbuch daraus gemacht, das den schönen Titel trägt: »Die Sprache des Geldes und warum wir sie nicht verstehen (sollen)«. Darin erklärt der 1962 geborene und in Hongkong aufgewachsene Sohn eines Bankers für den Laien möglichst verständlich die kryptische und oft kaum nachvollziehbare Sprache der Finanz- und Geldwirtschaft.
Denn die versteht im Grunde fast niemand. Oder wissen Sie was ein Vanilla-Mezzanine-RMBS-CDO ist? Dieses Wertpapier ist ein mittelmäßig riskantes Hypothekenbündel in Form einer verbrieften Kreditanleihe. Auch das hört sich noch sperrig genug an. »Die Sprache der Finanzwelt ... ist mächtig und effizient, hat aber auch einen ausschließlichen und ausschließenden Charakter«, so Lanchester, der diese Fachsprache mit der von Klempnern oder Krankenschwestern vergleicht.
Normalerweise muss sich niemand mit so etwas auseinandersetzen. Aber seit Beginn der Krise geht uns die Finanzwelt alle auf eine existenzielle Art an. Sich nicht mehr darum zu kümmern, geht nach Meinung Lanchesters nicht. »Jeder sollte verstehen, was eine inverse Renditekurve ist und weshalb sie einem Angst einjagen kann.«
Neben einem längeren einleitenden, recht süffig geschriebenen Essay zum Thema Finanzwirtschaft und Krise, ist dieses Buch vor allem ein Lexikon. Darin finden sich grundlegende ökonomische Begriffe wie Abschreibung, Inflation oder Zinssatz, aber auch kurze Texte zu bekannten Ökonomen wie John Maynard Keynes, Friedrich Hayek, Milton Friedman und Karl Marx. Natürlich wartet dieses an Anekdoten reiche und hinlänglich mit britischem Humor verfasste Buch auch mit Exotischem auf. So mit der Phillipsmaschine, die aus alten Flugzeugteilen zusammengebaut wurde. Damit wollte ihr Erfinder Bill Phillips anhand von Wasserströmen die gesamte britische Volkswirtschaft der 1950er anschaulich abbilden. Lanchester dient dieser absurde Versuchsaufbau als Beispiel für die unter Wirtschaftswissenschaftlern verbreitete Manie, sich ökonomische Zusammenhänge vor allem in berechenbaren Modellen vorzustellen. Die Finanzkrise hat seiner Meinung nach auch mit dieser Modellgläubigkeit zu tun, die Märkte als berechenbare Größen versteht.
Trotz seiner durchaus kritischen Haltung gegenüber der Finanzindustrie ist Lanchester aber keineswegs ein linker Systemkritiker. Auch wenn er sich deutlich als Gegner des Neoliberalismus positioniert (wegen sozialer Ungleichheiten und des unbedingten Glaubens an die Macht der Märkte), grenzt er sich immer wieder von klassischen linken Positionen ab. Die Marx'sche Werttheorie, so vermerkt er sogar, gelte »allgemein als Blindgänger«. Lanchester setzt stattdessen immer wieder recht naiv auf einen gesunden Menschenverstand. Ob der angesichts der heutigen Finanzindustrie und Austeritätsprogramme tatsächlich etwas hilft, ist nur schwer vorstellbar. Dennoch ist ein gewisses Verständnis für die Sprache dieser Geldwirtschaft unerlässlich, um überhaupt zu verstehen, weswegen internationale Großbanken wie Barclays und UBS im Zuge des Libor-Skandals Strafen in dreistelliger Millionenhöhe bezahlen müssen. Sie wissen nicht, was der Libor-Skandal ist? Schlagen Sie es nach!
John Lanchester: Die Sprache des Geldes und warum wir sie nicht verstehen (sollen). Klett-Cotta. 352 S., geb., 19,95 €.

Mehr Infos auf www.dasnd.de/genossenschaft
Das »nd« bleibt gefährdet
Mit deiner Hilfe hat sich das »nd« zukunftsfähig aufgestellt. Dafür sagen wir danke. Und trotzdem haben wir schlechte Nachrichten. In Zeiten wie diesen bleibt eine linke Zeitung wie unsere gefährdet. Auch wenn die wirtschaftliche Entwicklung nach oben zeigt, besteht eine niedrige, sechsstellige Lücke zum Jahresende. Dein Beitrag ermöglicht uns zu recherchieren, zu schreiben und zu publizieren. Zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit deiner Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Sei Teil der solidarischen Finanzierung und unterstütze das »nd« mit einem Beitrag deiner Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.