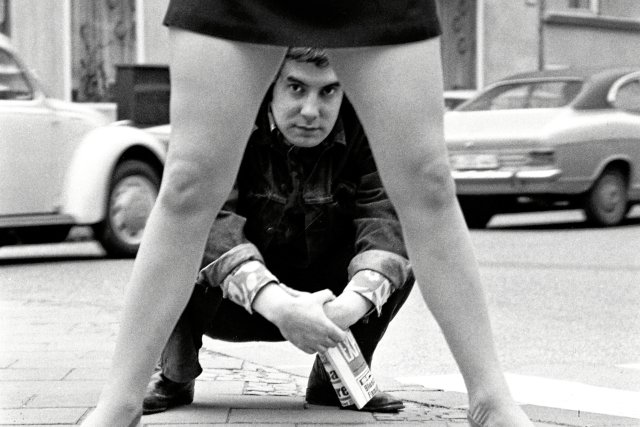Fatales Entweder-Oder
Das Buch von Ines Geipel und Joachim Walther hätte unterdrückten und vergessenen Autoren der DDR eine Bühne bieten können, doch es verlor sich in Hass
Angesichts der Geschichte sind wir alle Verstrickte. Es sei denn, wir hörten auf zu handeln und uns einzumischen. Manchmal will einer genau das: aufhören, bei etwas mitzutun, etwas nicht länger durch eigene Anwesenheit zu legitimieren, dem das Gewissen widerspricht. Aber dann bleibt er doch, entweder, weil er durch äußere Umstände dazu gezwungen wird oder weil er befürchtet, andere an seiner Stelle würden alles noch schlimmer machen. Die ewigen Qualen des Gewissens, wer kennt sie nicht?
Allgemein philosophisch ist das eine durchaus kommode Haltung. Aber wenn es historisch konkret wird, will man doch wissen: Wer sagte und tat oder unterließ was und welche Folgen hatte dieses Tun oder Unterlassen für andere? So beginnt jede polizeiliche Untersuchung - und auch die Geschichtsschreibung. Doch einen wichtigen Unterschied gibt es: Die Arbeit des Historikers ist das Aufzeigen von Verhältnissen, die das Handeln von Menschen in einer Zeit bestimmen, obwohl sie - Tücke der Dialektik - diese Verhältnisse durch eben ihr Handeln immer wieder reproduzieren.
»Wir kamen in einen sehr großen Raum, eine Kreissäge stand dort , Schraubstöcke. Jetzt geht richtig was los, hab ich gedacht, ein Mann kam und gab uns allen ein Stück graue Pappe. Erst schneiden wir die Ränder ganz gerade, hat er gesagt, und wer das gemacht hat, dem stemple ich einen Vogel drauf, den malt ihr dann grün. Als der Lehrer zu mir kam mit dem Stempel, hatte ich schon selbst einen Vogel gemalt. Wir malen alle den gleichen Vogel aus, hat der Lehrer gesagt, gab mir ein neues Stück Pappe, stempelte, und daß du nicht über den Rand malst! Ich Idiot habs so gemacht, und am Ende hatte ich den gleichen Vogel wie alle.«
Aus »Jochen Schanotta« von Georg Seidel, einem Stück über einen jugendlichen Verweigerer in der Nachfolge von Plenzdorfs anarchistischem Helden Edgar Wibeau aus den »Neuen Leiden des jungen W.«. Das DDR-Bildungsministerium unter Margot Honecker startete gegen das Stück 1985 eine Kampagne mit dem Ziel des Verbots. Seidel war ab 1975 Beleuchter und von 1982 bis 1987 dramaturgischer Mitarbeiter am Deutschen Theater Berlin und gilt heute als einer der wichtigsten DDR-Dramatiker der 80er Jahre. Er starb 1990 mit 44 Jahren an Krebs. Gunnar Decker
So ist der Mensch vor der Geschichte immer zugleich Opfer und Täter. Aber rechtfertigt eine solche Sicht nicht jedes Verbrechen, verhindert also, dass Verantwortliche namentlich genannt werden? Nein, im Gegenteil, eine solche Sicht vermeidet jene Form von selbstgerechtem Moralismus, der sich zum Richter macht über das Handeln anderer, vor allem in Zwangssituationen.
Das ist kein exklusiv deutsch-deutsches Thema. Der argentinische Papst Franziskus hat, als er noch Jorge Mario Bergoglio hieß und als Angehöriger des Jesuitenordens Bischof in Buenos Aires war, sich nachweislich für eine »arme Kirche« eingesetzt. Die Jesuitenbrüder betätigten sich auch während der Militärdiktatur als Seelsorger und Sozialarbeiter in den Armenvierteln. Da einige von ihnen hierbei in Verbindung zu militanten Regimegegnern kamen, wurden auch sie eingesperrt, gefoltert oder sogar ermordet. Und Bergoglio trug die Verantwortung auch für sie. Tat er wirklich alles, sie zu schützen? Darum streitet man nun in Argentinien. Einige seiner Mitbrüder werfen ihm sogar vor, er habe nicht nur unterlassen, sie zu schützen, sondern sogar zeitweise mit dem Militär paktiert. Ein Mitschuldiger auch dieser Papst, der heute doch so glaubwürdig in seinem Einsatz für eine gerechtere Welt wirkt? Das führt zu sehr grundsätzlichen Fragen: Bis wann ist das eigene schuldverstrickte Vorleben ein Motor für die Katharsis danach? Ab wann bleibt man schlicht ein Schuldiger, dem man nichts mehr glaubt? Bergoglio schreibt in seinem Buch »Über die Selbstanklage. Eine Meditation über das Gewissen«, Selbstanklage allein schütze davor, über dem Splitter im Auge des anderen, den Balken im eigenen zu übersehen. Über die notorischen Verfolger, diese im »Mechanismus des Argwohns« Gefangenen, die von einer »strukturellen Gier« getrieben würden, heißt es: »Diese Selbstversklavung führt auch zu einer Schwächung der Urteilskraft. Das Urteil verliert an Treffsicherheit.«
Wir sind bei Ines Geipel und Joachim Walthers Band »Gesperrte Ablage. Unterdrückte Literaturgeschichte in Ostdeutschland 1945 - 1989«. Wer hier eine Zusammenstellung von Biographien und Texten von Autoren sucht, die aus verschiedensten Gründen in der DDR nicht gedruckt wurden, sieht sich in der Simplizität der eigenen Erwartung getäuscht. Denn Geipel/Walther wollen nicht weniger als eine Destruktion dessen, was sie für die Existenzlüge der DDR halten und ihren »antifaschistischen Gründungsmythos« nennen. Dieser sei eine reine Herrschaftslüge gewesen, Maske des Totalitarismus.
So beziehen sie ihrerseits Stellung im Schützengraben der Klassenkämpfer, jedoch ostentativ auf der Seite eines Gerhard Löwenthal (falls jemand das ZDF-Pendant zu Karl-Eduard von Schnitzler heute noch kennt), der mit aller wiederbewaffnenden Klarheit zu erkennen glaubte, was der andere deutsche Staat im Grunde sei: ein einziges KZ.
Nichts anderes sagen - nicht zum ersten Mal, sondern mit der Routine derer, die ein Marktsegment bedienen - Ines Geipel und Joachim Walther. Ihre Sammlung, die verdienstvoll hätte sein können, gerät so zur Generalabrechnung mit dem DDR-Staat. Erstaunlich, wie viel Hass hier konserviert wurde. Geopfert wird dabei jedoch die Vielgestaltigkeit des künstlerischen Selbstverständnisses jener unterdrückten und oft vergessenen Autoren, denen das Buch zur Bühne hätte werden sollen. Doch hier, unter dem Etikett »Dissidenten« uniformiert und ins ideologische Entweder-Oder-Schema gepresst, bebildern sie bloß die generalisierenden Thesen der Autoren. Man darf das Instrumentalisierung nennen.
Das Buch schlägt einen Bogen vom »Archipel der Angst«, so die Charakterisierung der Anfangszeit, zu »DDR-Agonien« der 80er Jahre. Das dabei vorkommende Personal hätte zu einer lesenswerten Außenseitergeschichte werden können, einer »Literaturgeschichte von unten« - wenn die ideologische Entlarvungsabsicht, der die eigene Schreibkunst jederzeit Waffe ist, nicht derart dominierte.
Der kurze Aufstieg und jähe Fall der ebenso hochbegabten wie schönen Susanne Kerckhoff (der Schwester des Philosophen Wolfgang Harich), die sich 1950 mit 32 Jahren das Leben nahm, lässt über die Frage mutmaßen, ob hier eine zweite Brigitte Reimann starb, bevor sie ein Lebenswerk schuf. Dieses Kapitel hat - als einziges - eine gewisse Eindringlichkeit, vielleicht weil sich Ines Geipel bereits ausgiebig mit ihr beschäftigt hat, sie mehr interessiert als die anderen im Buch Vorgestellten, von denen man keine rechte Vorstellung bekommt: Ursula Adam, Eveline Kuffel, Herbert Bräuning, Edeltraut Eckert, Henryk Bereska, Norbert Randow, Fritz Kuhn, Günter Ullmann, Klaus Kurt Rohleder und zahlreiche andere.
Beide Autoren schrieben je ein Vorwort. Das von Geipel heißt »Gedächtnisspiegel Buchenwald« und bezieht sich auf Bruno Apitz’ Roman »Nackt unter Wölfen«, der den Widerstand des internationalen kommunistischen Lagerkomitees bis hin zur Selbstbefreiung des Lagers zum Thema macht und in den Mittelpunkt der Geschichte ein verstecktes jüdisches Kind stellt. Das Kind symbolisiert Hoffnung mitten in der Hölle, es muss überleben. Dieses Buch sei ein »Politmärchen« ganz nach Ulbrichts Geschmack gewesen, der damit den Heldenmythos des kommunistischen Widerstands beglaubigt sah - die Lebenslüge des SED-Staates DDR, meint Geipel. Die Wahrheit habe anders ausgesehen. Die kommunistischen Kapos, die das Lager regierten, seien nicht nur willige Mörder im Auftrag der SS gewesen, sondern hätten sogar in eigener Regie missliebige Genossen oder vermeintliche Spitzel liquidiert. Die Tatsache an sich ist nicht neu. Thomas Heise hat noch zu DDR-Zeiten ein Gespräch mit dem Schauspieler Erwin Geschonneck (Kapo im KZ Dachau) fürs Radio geführt, in dem dieser offen davon sprach, dass sie Kriegsgefangene »abspritzen« mussten. Das Gespräch durfte daraufhin nicht gesendet werden.
Allerdings eine schwere Mitschuld! Doch wer meint ernsthaft, man könne in dieser Lagerwelt sein, in der immer Vernichtung drohte, ohne sich selbst schuldig zu machen, ohne Schaden an der eigenen Seele zu nehmen? Geipel schreibt: »Der Komplex Buchenwald als die zementierte gedächtnispolemische Achse der DDR. Es dürfte keinen Ort in Deutschland geben, an dem sich rote und braune Gewaltwelten so nahe kamen und im Nachhinein derart kategorisch wieder getrennt wurden.« Das allerdings verschleiert die Tatsache, dass auch die Kommunisten im Lager jederzeit bedrohte Gefangene waren - und eben nicht freiwillige Partner beim Morden an Mithäftlingen, wie Geipel suggeriert. Unerwähnt bleibt hier das Misstrauen, das die aus Moskau kommende Gruppe Ulbricht den selbstbewussten Buchenwald-Kommunisten entgegenbrachte; einige der führenden Köpfe des illegalen Lagerkomitees wurden dann auch umgehend vom Geheimdienst NKWD verhaftet und nach Russland verschleppt.
Tatsächlich könnte ein Satz von Christoph Hein das Schein-Problem von »dissidentischer« contra »Staatskunst« gerade rücken. Das härtere Klima bringe die schöneren Blumen hervor. »Das spricht nicht für das härtere Klima. Kunst ist eine seltsame Pflanze.« Man müsste hier über Wandlungen von Autoren und von politischen Verhältnissen gleichermaßen reden. Auch Stefan Heym konnte »Der Tag X« (später unter dem Titel »Fünf Tage im Juni« erschienen) über den Arbeiteraufstand von 1953 nicht in der DDR veröffentlichen, weil es nicht zur offiziellen Lesart der SED vom »faschistischen« Aufstand passte. In Westdeutschland durfte das Buch zu der Zeit ebenfalls nicht erscheinen, weil der Autor ein bekennender Kommunist war.
Die Auswahl für das »Archiv der unterdrückten Literatur in der DDR«, dessen Katalog die letzten hundert Seiten des Buches füllt, schließt sich in ihrer Willkürlichkeit dem Leser nicht auf. Immerhin, Ralf Günther Krolkiewicz kommt vor. Er saß längere Zeit im Gefängnis und war in den 90er Jahren Intendant des Hans-Otto-Theaters Potsdam, bis man den Ostbeschädigten in der nun repräsentativ glänzen wollenden Landeshauptstadt nicht mehr haben wollte - kurz darauf starb er. Seine wunderbaren Stücke wie »Herbertshof« wurden fortan im kleinen »Theater 89« aufgeführt, das kürzlich aus der von Immobilienspekulanten umkämpften Berliner Mitte aufs Brandenburger Land umziehen musste.
Wer nicht vorkommt, ist Georg Seidel. Mit seinen so kraftvollen Jugend-Stücken wie »Carmen Kittel« oder »Jochen Schanotta« hätte er zum Held einer skeptischen DDR-Generation der 80er Jahre werden können. Auch er überlebte die Wende nur kurz.
Wenn altes Unrecht endet, beginnt leider oft ein neues.
Ines Geipel/Joachim Walther: Gesperrte Ablage. Unterdrückte Literaturgeschichte in Ostdeutschland 1945 - 1989. Liebeskind Verlag. 432 S., geb., 24,90 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.