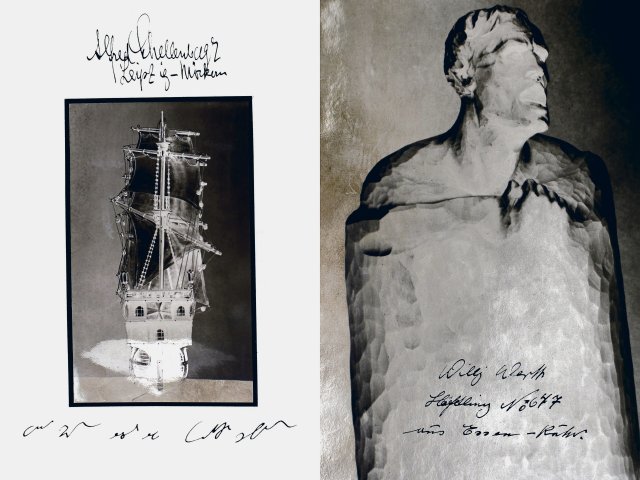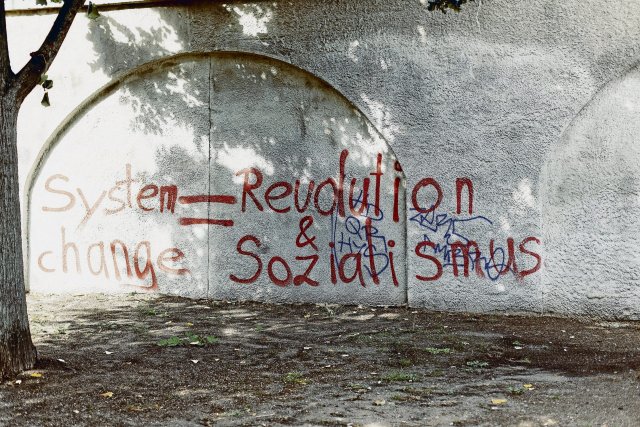Im technischen Nervenzentrum
Die Schau »Nervöse Systeme - Quantifiziertes Leben und die soziale Frage« im Haus der Kulturen der Welt
Nutzen Sie auch Smartphone, Tablet oder PC und haben nicht immer ein gutes Gefühl dabei? Zum Beispiel, weil Sie die technischen Möglichkeiten der Geräte nicht hinreichend durchschauen und nicht so wirklich genau wissen, wie weit die Vernetzungen gehen und wer alles Zugriff auf ihre Daten bekommen kann? Und stellen sie sich auch gelegentlich die Frage, ob sie überhaupt die Chance hätten, vorausgesetzt Sie verfügten über das Know-how, allein und selbstbestimmt über die von Ihnen erzeugten Daten und Informationen zu verfügen? Wer sich mit solchen Überlegungen beschäftigt, sollte unbedingt die aktuelle Ausstellung »Nervöse Systeme - Quantifiziertes Leben und die soziale Frage« im Haus der Kulturen der Welt besuchen. Denn hier steht die voranschreitende »Objektivierung« unseres Selbst in einer zunehmend datenorientierten Gesellschaft im Zentrum einer Analyse mit künstlerischen Mitteln.
Die Schau zeigt auch, inwiefern die heutigen, allgegenwärtigen sensorgesteuerten Kontrollsysteme aus »nervösen Netzen« und unbegrenzten Datenanhäufungen (big data) auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Und sie bietet praktische Hilfe in Form von Workshops an, bei denen man etwa mit einer »Google Diät« oder durch »Reisen mit Tor« wieder ein Stück weit die Kontrolle über sich selbst zurückgewinnen kann.
Quantifizierung bedeutet ja zunächst einmal lediglich die Messbarkeit bestimmter Sachverhalte in Zahlenwerten und Mengenbegriffen. Um das zu veranschaulichen, hat das Kuratorentrio Anselm Franke, Stephanie Hankey und Marek Tuszynski den Ausstellungsraum vorübergehend in ein dreidimensionales Raster oder »Grid« verwandelt. In dieses technische »Nervensystem« fügen sich die 28 künstlerischen Beiträge aus dem Entstehungszeitraum zwischen 1973 und 2016 ein. Vito Acconcis Video »Theme Song« (1973) ist ein frühes Zeugnis für die starke Suggestivkraft medialer Bilder: Der altmodisch wirkende Schwarz-Weiß-Film erzeugt in seiner penetranten Anzüglichkeit noch immer spürbares Unbehagen beim Betrachter. Im Vergleich dazu wirkt Alex Verhaests interaktive Videoinstallation »Dinner Scene« (2014), als Kritik an der verflachenden Wirkung sozialer Medien gedacht, trotz modernster Animationstechnik recht verspielt und diffus. Der Zuschauer kann die neunminütige Filmszene mit dem schwermütigen Monolog einer Familie nach dem Tod des Vaters aktivieren, indem er eine Handynummer anruft.
Die Mediengruppe Bitnik hat Julien Assanges Arbeitszimmer in der ecuadorianischen Botschaft in London maßstabsgetreu als begehbare Installation nachgebaut. Die Replik symbolisiert das theoretische Geflecht aus Beschränkung, Kontrolle und Macht in der Beziehung zwischen Individuum, Gesellschaft und Staat und entstand als bleibender Nachklang einer Live-Onlineperformance von 2013. Damals hat die Gruppe Assange ein Postpaket mit einer funktionierenden Überwachungskamera zugeschickt. Postweg und Zustellung wurden so in Echtzeit visuell getrackt und einzelne Bilder der Kamera über Twitter verbreitet.
Die strenge Ordnung der Ausstellungsarchitektur wird von zehn »Triangulationen« akzentuiert, die von Theoretikern, Philosophen oder kritischen Ingenieuren gestaltet sind. Hinzu kommt als dritter Teil der sogenannte »White Room« des Kollektivs »Tactical Tech«, in dem die Besucher zur aktiven Teilnahme eingeladen sind. Falls gewünscht auch mit fachkundiger Unterstützung durch fortgeschrittene Internetnutzer, Experten für Guerillakommunikation oder sonstige kritische Fachleute der boomenden datenorientierten Gesellschaft.
So lustig das klingt, so ist es doch eine äußerst ernste Angelegenheit. Spätestens seit WikiLeaks und Edward Snowden ist bekannt, wie weit Kontroll- und Überwachungstechnologien in der datenorientierten Gesellschaft bereits vorangeschritten sind. Somit betreffen die Fragen, die hier verhandelt werden, nichts weniger als unsere persönliche Freiheit und Formen der Einschränkung von Menschenrechten und Meinungsfreiheit durch Möglichkeiten uneingeschränkter Kontrolle und Quantifizierung.
Bis 9. Mai. Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10, Berlin-Tiergarten, Mi-Mo und feiertags 11-19 Uhr, White Room 12-18 Uhr, Eintritt 6/4 Euro, montags freier Eintritt, www.hkw.de
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.