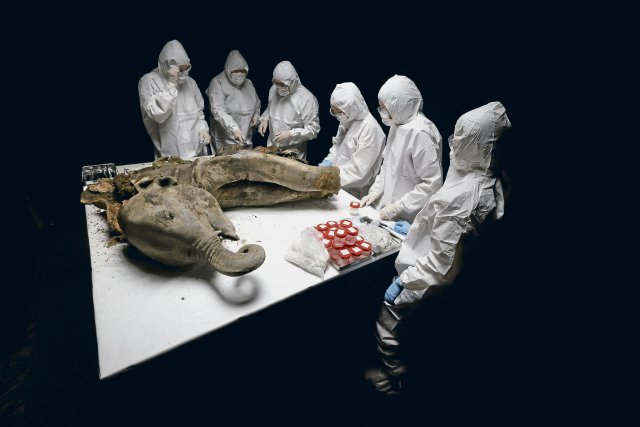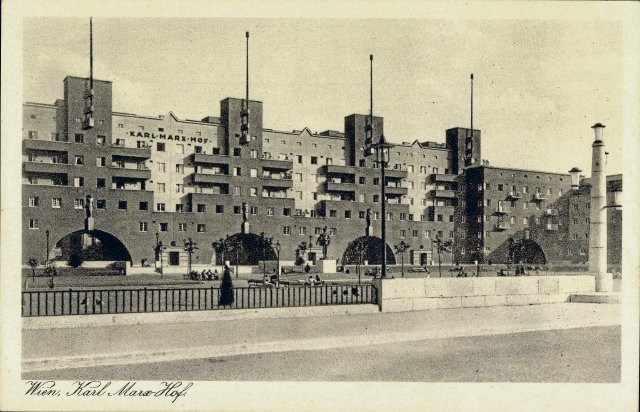Unfruchtbar und mehret sich
Bereits 20 Prozent Spaniens gelten nach einer neuen Studie als Wüste. Nur eine weniger intensive Bodennutzung kann deren Ausbreitung aufhalten
Seit Langem ist Wüstenbildung in Spanien ein Thema. Sie haben die Entwicklung genauer untersucht und die Ergebnisse in der Fachzeitschrift »Science of the Total Environment« vorgestellt. Kann das Ausmaß des Problems nun beziffert werden?
Diese Arbeit ist Teil verschiedener Studien, die vom Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt vor drei Jahren in Auftrag gegeben wurden. Teilergebnisse wurden schon veröffentlicht, jetzt hat für etwas Aufregung gesorgt, dass schon 20 Prozent des Territoriums als Wüste anzusehen sind.
Die Desertifikation, wie man die vorschreitende Wüstenbildung auch nennt, wird ein immer größeres Problem. Schon ein Drittel der Erdoberfläche ist davon bedroht. 1992 wurde auf der Konferenz der Vereinten Nationen (UN) über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro neben dem Klimawandel und dem Verlust von Artenvielfalt die Wüstenbildung als eine der großen Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung benannt.
Der fortschreitende Klimawandel verstärkt zugleich die Desertifikation. Klimaforscher stellen fest, dass Dürreperioden häufiger und intensiver werden. Das verschärft auf der einen Seite die Wüstenbildung und führt andererseits zu einem weiteren Verlust an Biodiversität.
Zunehmend gefährdet diese Entwicklung die Nahrungsmittelproduktion. Nach UN-Angaben leiden schon heute 1,5 Milliarden Menschen an den Folgen von Bodenverschlechterung und Wüstenbildung. Schon jetzt ist mehr als die Hälfte des verfügbaren Ackerlands weltweit von moderater oder starker Degradation betroffen. Jährlich gehen zwölf Millionen Hektar Ackerland verloren, in etwa soviel wie die gesamte Ackerfläche Deutschlands. Und die Tendenz ist steigend.
Auf der jährlich verlorenen Fläche könnten nach Schätzungen der UN etwa 20 Millionen Tonnen an Getreide angebaut werden. Besonders Menschen in Entwicklungsländern sind betroffen. Fast drei Viertel aller armen Menschen weltweit leiden direkt unter der Verarmung der Böden. 135 Millionen Menschen sind gefährdet, wegen Wüstenbildung zu Flüchtlingen vor Dürre und Hunger zu werden.
Um die Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu lenken, hat die UN 1994 den 17. Juni zum Weltwüstentag erklärt, der seit 1995 jährlich begangen wird. Erinnert wird daran, dass an diesem Tag die Verhandlungen über das internationale Übereinkommen zur Bekämpfung der Desertifikation in Paris erfolgreich abgeschlossen wurden. MSt
Was bedeutet es, dass 20 Prozent der Böden schon verwüstet sind? Wächst dort nichts mehr, hat die Sahara gewissermaßen die Meerenge von Gibraltar übersprungen?
Desertifikation ist eine Bezeichnung, die ein französischer Wissenschaftler zu Beginn des letzten Jahrhunderts eingeführt hat. Schnell wird assoziiert, dass die Sahara nach Spanien vorrücken würde. Aber es geht hier eher um Gebiete, in denen die Bodenfruchtbarkeit durch menschliche und klimatische Einflüsse verloren geht. Die Vegetation nimmt ab, es kommt zur Bodenerosion und die Landschaft verwandelt sich in eine Wüste. Die Sahara breitet sich nicht nach Spanien aus. Zudem sind auch Wüsten Ökosysteme, die ihren Platz auf der Erde haben.
Ihre Studie hebt hervor, dass derzeit ein Prozent des spanischen Territoriums starker Degradation ausgesetzt ist. In welchem Verhältnis steht das zur Wüstenbildung?
In den 20 Prozent drückt sich das Ergebnis verschiedener Phasen historischer Wüstenbildungen aus. Da ist zum Beispiel die Entwaldung im 16. Jahrhundert für den Schiffbau, dann die Minentätigkeit, als Holz und Holzkohle zum Schmelzen der Metalle verwendet wurden. Es wurde auch viel Wald gerodet, um Weideflächen zu schaffen, womit Flächen ihre Fruchtbarkeit verloren und zu Wüsten wurden. Im Vergleich erscheint ein Prozent des Bodens, das auf diesem Weg ist, wenig. Doch es ist eine riesige Fläche. Und es zeigt auch, dass dieser Prozess seit Jahrhunderten praktisch unumkehrbar ist.
Sie sprechen in der Studie auch von 30 Prozent des Landes, das produktiv ist, aber wenig Biomasse aufweist. Sind das Gebiete, die der Desertifikation ausgesetzt sein werden?
Geringe Biomasse an sich sagt darüber nicht viel aus. Wir schauen mit unserer Methodologie, welche Biomasse es potenziell geben müsste. In sehr trockenen Gebieten, wie hier im Südosten Spaniens, kann es kaum Biomasse geben. Wir untersuchen deshalb, welche Vegetation vorhanden ist, und vergleichen damit, welche es geben müsste. Wenn sie nicht den Gegebenheiten entspricht, verbirgt sich dahinter ein Degradationsprozess.
Welche Landschaften sind besonders anfällig für Wüstenbildung?
Als die Regierung 2008 das Programm zur Bekämpfung der Desertifikation veröffentlichte, wurden fünf Szenarien im Zusammenhang mit der Bodennutzung bestimmt. Entsprechende Gebiete finden sich verschiedentlich im Land. Da sind zum Beispiel die, die mit Oliven- oder Mandelbäumen bepflanzt sind, Gebiete mit landwirtschaftlichen Kulturen wie am Ebro oder am Guadalquivir. Dazu kommen bewässerte Flächen mit einer Übernutzung der Wasserreserven und überweidetes Gebiet wie die »Dehesa« in der Extremadura, aber auch Gebiete mit niedrigem Bewuchs, wo sich ebenfalls Wüstenbildung zeigt.
Und wo ist sie besonders stark?
Nach unseren Studien sind landwirtschaftlich genutzte Gebiete besonders stark von Erosion betroffen und am anfälligsten für Desertifikation. Das extensiv zum Ackerbau genutzte Land in der Provinz Córdoba kollabiert nach unseren Simulationen in rund 60 Jahren.
Welche Faktoren haben den größten Einfluss?
Wir haben fünf Beispiele untersucht, doch das erlaubt nicht, Rückschlüsse auf das ganze Land zu ziehen. Wir wollen aber eine Methode erarbeiten, die es erlaubt, das Desertifikationsrisiko allgemein abschätzen zu können. In diesen fünf Fällen waren klimatische Bedingungen besonders bedeutsam: Trockenheit, Niederschläge und Temperaturen. Menschliche Aktivitäten und ökonomische Faktoren dürfen aber nicht unbeachtet bleiben. Direkte oder indirekte Subventionen führen zum Beispiel zu einer intensiveren Flächennutzung und verstärkten Erosion.
Doch Klimaveränderungen gehen auch auf die Aktivität des Menschen zurück. Schließt sich damit nicht der Kreis wieder?
Natürlich. Nach Definition der Vereinten Nationen ist die Desertifikation auf Klimabedingungen und unsachgemäße menschliche Aktivitäten zurückzuführen. Wir sind für den Klimawandel mitverantwortlich, also letztlich für beide Faktoren. Aber das Klima folgt auch eigenen Gesetzmäßigkeiten, wo es trockenere, feuchtere, kältere und wärmere Phasen gibt. Die bewegen sich aber im Bereich von Jahrtausenden. Unser Einfluss wirkt sich schon in Jahrzehnten aus und das sind sehr schnelle Veränderungen.
Vor welchem Szenario steht die Iberische Halbinsel angesichts der Klimamodelle, die hier besonders starke Auswirkungen vorhersagen?
Angesichts von vorhersehbar weniger Niederschlägen, höheren Temperaturen und mehr Dürreperioden müssten die Böden weniger intensiv genutzt werden. Das ist die einzige Lösung, um ihrer Degradation zu begegnen. Das ist aber aus sozioökonomischen Gründen schwierig, da die Produktion meist auf eine kurzfristige Maximierung abzielt. Wir setzen auf eine langfristige Politik, die der entgegensteht, die auf kurzfristige und schnelle Rentabilität ausgerichtet ist.
Sie stellen Vorbeugung in den Vordergrund. Was kann die leisten?
Hat die Desertifikation begonnen, also wenn fruchtbarer Boden verloren geht, Grundwasserreserven übernutzt sind und Salzwasser eindringt, kann kaum noch etwas getan werden. Es gibt zwar technische Lösungen, doch die sind sehr teuer und im großen Maßstab kaum umsetzbar. Deshalb drängen wir auf Prävention, Planung, vernünftige Ressourcennutzung und Diversifizierung der Produktion. Andere realistische Optionen gibt es nicht. Wir orientieren auf Früherkennung, um Gefahren abschätzen zu können. Oft wird aber auf Großprojekte gesetzt, wie die Baum-Barriere für die Sahara, um deren Ausbreitung aufzuhalten. Doch dort ist Überweidung im Überlebenskampf der Menschen das Hauptproblem. Die bestimmenden Triebkräfte müssten deaktiviert werden. Das gilt genauso für die Überfischung der Meere, für die Abholzung von Wäldern, die alle auf eine Ursache zurückgehen und eine ähnliche Lösung haben. Doch eine Übereinkunft zwischen vielen Menschen ist schwierig zu erreichen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.