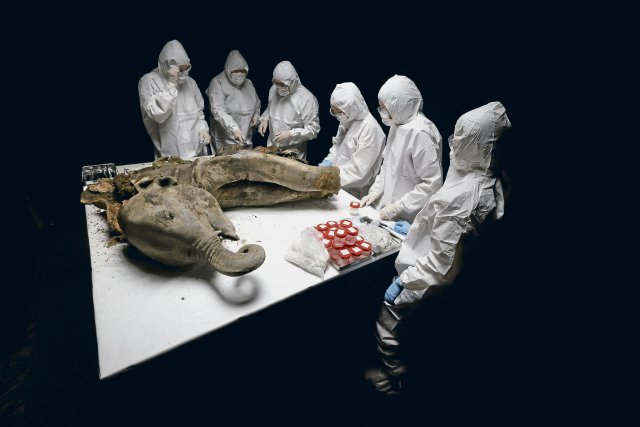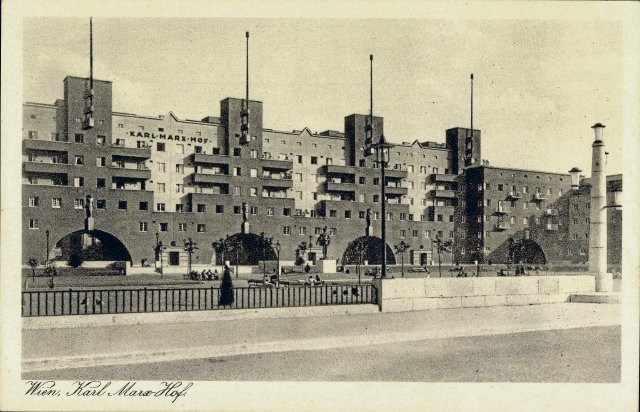»Wir müssen unsere Mentalität ändern«
Sadie Creese von der Universität Oxford über die Dimensionen von Cyberkriminalität
Bot-Netze legen Teile des Internets lahm, Identitätsdaten werden gestohlen und direkt zu Geld gemacht, aber auch Menschen und Unternehmen mit der angedrohten Veröffentlichung gestohlener Daten erpresst - wie würden Sie die verschiedensten Bedrohungen im Internet nach Wahrscheinlichkeit und Gefährlichkeit einordnen?
Das ist schwierig. Was ich sagen kann, ist, dass der Markt der Cyberkriminalität sehr schnell wächst. Schätzungen vergleichen die Dimensionen der Cyberkriminalität bereits mit denen des weltweiten Drogenhandels. Das ist besorgniserregend. Bei der Bedrohungsanalyse müssen wir aber auch berücksichtigen, dass Cyberkriminalität nicht nur für die Kriminellen selbst attraktiv ist, sondern auch für andere Teile der Gesellschaft. Wir müssen akzeptieren, dass es keine sicheren Areale mehr gibt, dass der Feind bereits im Haus ist und Firewalls uns nicht absolut schützen.
Das bedeutet, wir müssen den Cyberspace wieder mehr als eine Wildnis betrachten, in der Gefahren lauern, und nicht als Erweiterung des eigenen und damit gefahrlosen Wohnzimmers ansehen?
Ja. Dabei sind wir aber vor Probleme gestellt. Menschen haben gelernt, mit vielen Arten von Gefahren umzugehen. Wir können etwa ganz gut erkennen, wann jemand lügt. Aber warum trotz besseren Wissens immer noch viele Menschen auf Mails antworten, in denen sie zur Geldwäsche aufgefordert oder ihnen Lottogewinne versprochen werden, das können momentan nicht einmal die Psychologen beantworten. Wir müssen für das Netz unsere Mentalität ändern.
Sadie Creese ist Expertin für Internetsicherheit und forscht dazu an der Universität Oxford. Die Wissenschaftlerin sprach in Berlin im Rahmen der »Falling Walls«-Konferenz über die Mauern, die einzureißen sind, um zu einem sichereren Internet zu kommen. Tom Mustroph sprach mit ihr über die Dimensionen von Cyberkriminalität.
Wie hoch schätzen Sie die Gefahren durch das Internet der Dinge ein, durch immer mehr vernetzte Geräte, die dann zu Bot-Netzen zusammengeschaltet sogar Infrastrukturen ernsthaft beschädigen können?
Bot-Netze kann man damit vergleichen, dass Kriminelle nicht mehr nur mit einem Baseballschläger einschlagen, sondern mit Hunderten, Tausenden, ja Millionen Keulen zugleich. Das ist ein Gefahrenpotenzial, das immer größer wird, weil eben auch der Nutzen, der durch diese Geräte entsteht, groß ist und deshalb der Gebrauch zunimmt.
Was lässt sich dagegen tun?
Man muss die Gefährdungslagen analysieren und für mehr Transparenz und mehr Handlungsmöglichkeiten sorgen. Menschen müssen erkennen können, wann ihre Geräte von anderen gekapert werden und sie müssen in der Lage sein, sie zu resetten und so aus dem kriminellen Netzwerk herauszulösen. Dazu braucht es aber Wissen, stärkeres Bewusstsein für die Gefahren und mehr Transparenz seitens der Hersteller.
Bisher wurden Bot-Netze hauptsächlich für DDoS-Attacken, also künstlich herbeigeführte Serverüberlastungen, eingesetzt. Mit den Millionen Baseballschlägern wurde, um im Bild zu bleiben, durch die Schlagfrequenz so viel heiße Luft erzeugt, dass die Kühlung nicht mehr hinterher kam. Der nächste Schritt wäre aber doch, all diese Geräte, die ja auch selbst fahrende Autos, Industrieroboter oder Drohnen sein können, zu direkten Angriffen auf die physische Welt zu organisieren. Wie groß ist diese Gefahr? Und wie kann man sich dagegen wehren?
Ja, da ist sehr vieles möglich. Das ist eine potenzielle Armee, die da in Bewegung gesetzt werden kann. Und es ist wirklich nicht gesagt, dass sich der Einsatz von Bot-Netzen auf DDoS-Attacken beschränken wird. Wehren kann man sich nur, indem man eingreift, bevor die Geräte in Bewegung gesetzt werden. Da muss man in automatische Erkennung investieren. Und man muss Nutzer befähigen, ihre Geräte aus diesen Netzwerken herauszunehmen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.