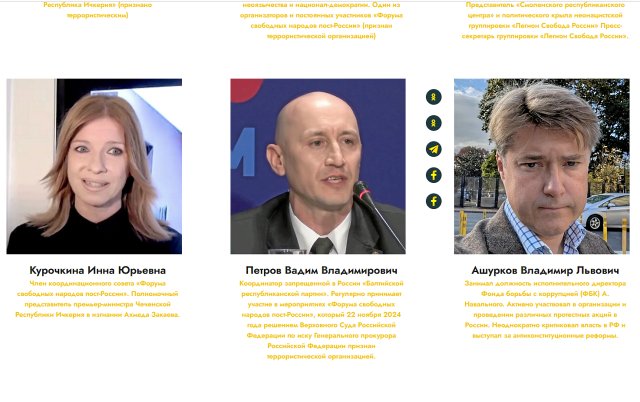Magdeburg strebt an die Nordsee
Ein »Gesamtkonzept« soll der Elbe eine Zukunft als Schifffahrtsweg und als Biotop geben
Magdeburg erhält für den Ausbau seines Binnenhafens Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. Rund 36 Millionen Euro fließen als Fördermittel, nur vier Millionen muss die Stadt aufbringen. Den Förderbescheid übergab Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Montag. Nach drei Jahren soll der Hafen dann unabhängig vom Wasserstand des Flusses werden. Geplant ist dazu ein besserer Anschluss an das europäische Kanalnetz.
Magdeburgs Hafen liegt sowohl an der Elbe als auch an einem Wasserstraßenkreuz mit mehreren, stets schiffbaren Kanälen. Seit 2013 gibt es zwar eine Niedrigwasserschleuse. Die macht aber nur ein Hafenbecken unabhängig vom Wasserstand der Elbe und jederzeit anfahrbar.
Die Ausbaupläne kommen möglicherweise verspätet. Denn fast zeitgleich beschloss die Bund-Länder-Runde das »Gesamtkonzept Elbe«. Das Öko- und Verkehrskonzept sieht eine Vertiefung der Oberelbe auf 1,60 Meter vor. Damit wäre der Fluss wieder nahezu ganzjährig schiffbar. Streckenweise beträgt die Tiefe zwischen Hamburg und Magdeburg derzeit bei Niedrigwasser nur einen Meter. Der Schiffsverkehr ruht dadurch in meteorologisch ungünstigen Jahren monatelang nahezu vollständig.
Im Gegenzug wurden zahlreiche Maßnahmen verabschiedet, die dem Umweltschutz dienen sollen. Die Elbe ist der letzte größere, weitgehend frei fließende Fluss in Deutschland. Die Erosion des Flussbettes führt jedoch zu einer Absenkung des Grundwassers. An den Ufern geht das Wasser zurück, uralte Auwälder trocknen aus. Besonders zwischen Mühlberg in Brandenburg und der Saalemündung besteht dieses Problem. Ein Stabilisierungskonzept soll nun die Gewässersohle standfest machen.
»Mit großer Erleichterung« reagierten die Wirtschaftsverbände auf den Beschluss der Bund-Länder-Runde. Nach mehr als einem Jahrzehnt des Stillstandes sei dieser ein »Riesenerfolg«, sagt Henning Finck, Vertreter der Kammerunion Elbe/Oder. Verhandlungsführer der Binnenhäfen, des Hamburger Hafens und des Schiffbauverbandes VSM stimmten in den Jubel ein. Das Konzept verstehen die Wirtschaftsvertreter als Ende des bisherigen Moratoriums, welches für den Stillstand an der Elbe sorgte. Noch offene Fragen würden nun in einem Anschlussprozess gemeinsam bearbeitet werden.
Vorausgegangen waren jahrelange Verhandlungen, weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beteiligt waren neben Bund, Ländern und Wirtschaftsverbänden auch Umweltorganisationen, Kirchen und die Tschechische Republik. Die Elbe ist für Tschechien die - durch die Versailler Verträge von 1919 eigentlich garantierte - Verbindung zum Seehafen Hamburg und damit zu den Weltmärkten. Notwendig ist dafür aber eine »Tauchtiefe« von 1,60 Meter. Zwar liegen selbst große, über hundert Meter lange Frachtschiffe voll beladen nur 1,40 Meter tief im Wasser - aus Sicherheitsgründen sind jedoch weitere 20 Zentimeter als »Flottwasser« notwendig. Tschechische Reedereien betreiben umfangreiche Flotten mit Binnenschiffen.
Auch Umweltschützer tragen das »Gesamtkonzept Elbe« mit, wenngleich es manchem Kritiker nicht »grün« genug ist. Doch der Stopp und die Umkehr der Sohlerosion - ein wichtiger Punkt für die Umweltschützer - stünden nun ganz oben auf der Agenda von Bund und Ländern. »Damit haben wir eines der wesentlichen Naturschutzziele verankert«, sagt NABU-Präsident Olaf Tschimpke. Und Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND, lobt, dass Bund und Länder den Schutz der Elbe »endlich gemeinsam angehen wollen«. Die Umsetzung wird sich allerdings jahrelang hinziehen. Nicht alle Konfliktpunkte scheinen intern ausgeräumt. Offen ist auch die Finanzierung. Und über die ganze Strecke von 600 Kilometern zwischen der tschechischen Grenze und Hamburg müssen die konkreten Maßnahmen in Regionalforen mühsam abgestimmt werden, bevor es an die Realisierung gehen kann. Doch dann dürfte der Magdeburger Hafen - zweitgrößter Binnenhafen im Einzugsgebiet der Elbe - tatsächlich keinen Niedrigwasseranschluss an das Kanalnetz bis zur Nordsee mehr benötigen.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.