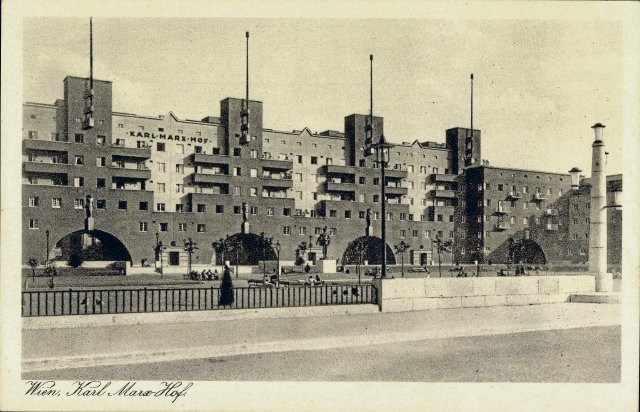»Eine großartige Entdeckung«
Exoplaneten-Fund schürt die Hoffnung auf den Fund weiterer Planeten
Was ist die bewohnbare Zone?
Als bewohnbare Zone bezeichnen Astronomen jenen Bereich um einen Stern, in dem die Temperaturen die dauerhafte, großräumige Existenz von flüssigem Wasser erlauben. Dabei wird in der Regel der Treibhauseffekt einer potenziellen Atmosphäre einbezogen. Ob die Planeten von Trappist-1 eine Atmosphäre haben, wissen ihre Entdecker allerdings noch nicht.
Warum ist flüssiges Wasser so wichtig?
Es gilt als Grundvoraussetzung für alles Leben, wie wir es kennen.
Haben die Forscher flüssiges Wasser auf den Planeten von Trappist-1 entdeckt?
Nein, danach haben sie auch nicht gesucht. Sie haben nur die Existenz der Planeten selbst entdeckt. Direkt hat die Planeten noch niemand gesehen. Die Forscher beobachteten, dass der Stern Trappist-1 regelmäßig kleine Schwankungen in der Helligkeit erfährt. Die entstehen, wenn die sieben Planeten auf ihren Umlaufbahnen von der Erde aus gesehen vor dem Stern vorbeiwandern und so ein kleines Stück von ihm abschatten. Den Effekt kann man sehr genau messen und daraus die Größe des jeweiligen Planeten bestimmen. Solche Exoplaneten lassen sich nur entdecken, wenn zufällig von der Erde genau auf die Kante eines solchen Systems geblickt wird.
Was bedeutet die Entdeckung der Planeten für die Suche nach außerirdischem Leben?
»Mehrere Planeten in der bewohnbaren Zone eines Sterns zu finden, ist eine großartige Entdeckung, denn es bedeutet, dass es noch mehr potenziell bewohnbare Planeten pro Stern geben kann als wir gedacht haben. Und mehr Gesteinsplaneten in der bewohnbaren Zone zu finden, erhöht definitiv unsere Chancen, Leben zu entdecken«, erläutert die Exoplanetenexpertin und Direktorin des Carl-Sagan-Instituts an der Cornell-Universität in den USA, Lisa Kaltenegger. »Trappist-1 hält jetzt den Rekord für die meisten Gesteinsplaneten in der bewohnbaren Zone - unser Sonnensystem hat zwei, Erde und Mars. Leben ist definitiv eine Möglichkeit auf diesen Welten, aber es sieht vielleicht anders aus, denn es gibt wahrscheinlich sehr hohe Level ultravioletter Strahlung auf der Oberfläche dieser Planeten.«
Wie geht es nun weiter?
Die Forscher schätzen, dass künftige Teleskope feststellen können, ob und was für Atmosphären die Planeten besitzen. Dazu analysieren Astronomen, ob und wie das Licht des Sterns durch eine Atmosphäre gefiltert wird, wenn der untersuchte Planet vor dem Stern vorbeiläuft. Beobachtungen der inneren beiden Planeten des Systems mit dem »Hubble«-Weltraumteleskop haben nach Angaben der NASA keine Hinweise auf eine aufgeblähte, wasserstoffreiche Atmosphäre wie etwa beim Planeten Neptun ergeben. Das stärkt die Annahme, dass es sich um Gesteinsplaneten wie unsere Erde mit vergleichsweise dünnen Lufthüllen handeln könnte. »Atmosphärische Biosignaturen wie Methan, die auf Anpassungen durch Leben hindeuten, könnten mit dem «James Webb»-Weltraumteleskop zu entdecken sein, das 2018 startet, oder mit dem European Extremely Large Telescope, das 2022 in Betrieb gehen soll«, schätzt Kaltenegger.
Welche anderen Kandidaten für außerirdisches Leben gibt es?
Die Universität von Puerto Rico pflegt einen Katalog bewohnbarer Exoplaneten. Er listete ohne das Trappist-1-System 44 Kandidaten bei verschiedenen Sternen auf. Die Universität vergibt einen Index für Erdähnlichkeit. Er wird bislang angeführt von dem bei Proxima Centauri entdeckten Exoplaneten, der unter dem Strich auf 87 Prozent Erdähnlichkeit kommt. Er ist mit einem Abstand von nur vier Lichtjahren zugleich der nächste potenziell bewohnbare Exoplanet. Das Trappist-1-System liegt zehnmal so weit entfernt - gehört aber noch zu unserer kosmischen Nachbarschaft. Daneben gibt es auch in unserem eigenen Sonnensystem Chancen, außerirdisches Leben zu finden. So suchen verschiedene Marsmissionen nach Lebensspuren auf dem Roten Planeten, und Astronomen vermuten bei großen Monden von Jupiter und Saturn sowie auf dem Zwergplaneten Ceres unterirdische Ozeane unter deren Eispanzern, in denen sich Leben entwickelt haben könnte. dpa/nd
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.