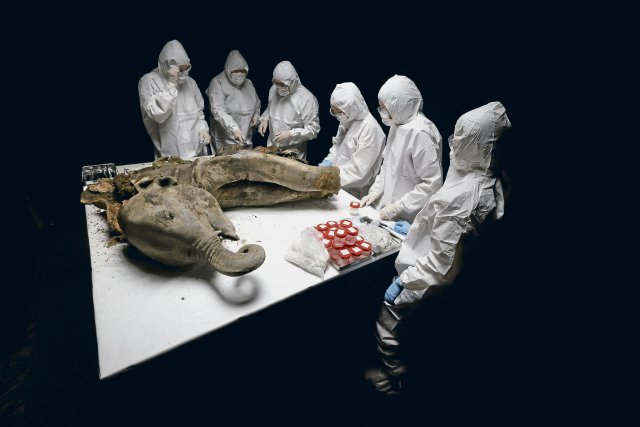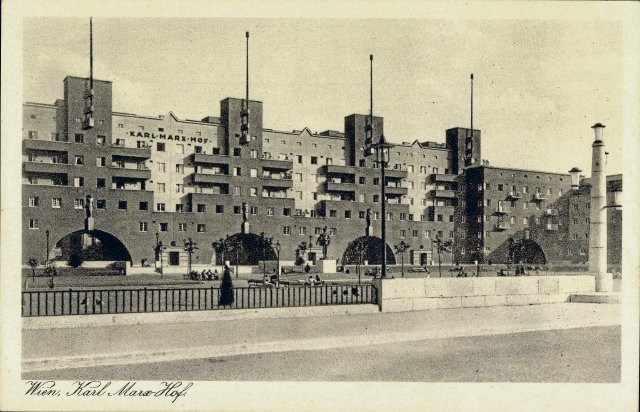Genetische Phantombilder sind eine Wunschvorstellung
Der Kölner Genetiker Peter Schneider über Möglichkeiten und Grenzen erweiterter DNA-Analysen in der Kriminalistik
Bislang gab es bei der Aufklärung von Verbrechen den sogenannten genetischen Fingerabdruck. Nun wird eine erweiterte DNA-Analyse gefordert. Was ist da anders?
Die klassische DNA-Analyse führt zum sogenannten DNA-Profil, das dann im Zweifelsfall in der DNA-Analyse-Datei im Bundeskriminalamt gespeichert wird. Mit dem DNA-Profil kann man eine Person eindeutig als Spurenleger identifizieren. Bisher ist das sehr erfolgreich. In der DNA-Analyse-Datei sind mittlerweile mehr als eine Million Datensätze gespeichert, ungefähr 800 000 DNA-Profile von verurteilten Straftätern und Tatverdächtigen aus laufenden Ermittlungsverfahren und ungefähr 250 000 DNA-Profile von Spuren aus nicht aufgeklärten Straftaten. Jede dritte Tatortspur, die man dort neu einstellt, bringt einen Treffer zu einer Person oder einer anderen Spur, so dass die Polizei weitere Ermittlungshinweise bekommt. Wenn man so aber nicht weiterkommt, dann kann man versuchen, aus der Spur noch mehr herauszulesen über die Person, von der die Spur stammt. Dazu dient die erweiterte DNA-Analyse.
In dem Zusammenhang wird gelegentlich von einem genetischen Phantombild geredet. Ist das eine Übertreibung?
Eine Wunschvorstellung. Im Idealfall würde man versuchen, aus genetischen Merkmalen ein Bild zu erzeugen. Denn tatsächlich sind auch Gesichter genetisch determiniert, wie wir an eineiigen Zwillingen sehen können. Das Problem ist nur, dass die genetischen Informationen für die Gesichtszüge so komplex sind, dass wir sie noch lange nicht entschlüsselt haben. Das ist eine Zukunftsvision, die wir mit viel Glück vielleicht in zehn Jahren erreichen werden.
Prof. Dr. Peter Schneider ist Leiter der Forensischen Molekulargenetik des Universitätsklinikums Köln und Vorsitzender der Spurenkommission der rechtsmedizinischen und kriminaltechnischen Institute in Deutschland. Steffen Schmidt sprach mit ihm über die Grenzen und die Möglichkeiten der erweiterten DNA-Analysen bei der Aufklärung von Straftaten.
Was lässt sich denn derzeit tatsächlich aus den DNA-Spuren ablesen?
Für die Anwendung bei Spuren sind Augenfarbe, Haarfarbe und mit Einschränkungen auch die Hautfarbe etabliert. Aussagen sind auch zur biogeographischen Herkunft möglich. Damit können wir die genetischen Wurzeln von Menschen aus Europa, dem subsaharischen Afrika, aus Ost- und Südasien unterscheiden. In Mittelasien, dem Nahen Osten und im Mittelmeerraum ist das schon sehr unübersichtlich. Die Gefahr ist in der Tat, dass die Politik und vielleicht auch die Polizei glauben, wir könnten länderspezifisch die Herkunft ermitteln. Das geht natürlich nicht.
Ihre Ergebnisse geben in der Regel Wahrscheinlichkeiten an. Wie gut können Ermittler und Gerichte damit umgehen?
Die sind das gewohnt, weil wir auch in der klassischen DNA-Analyse mit Wahrscheinlichkeiten operieren. Wenn es ein vollständiges DNA-Profil ist, dann braucht man über Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu diskutieren, da gibt es nur noch: Er war’s oder er hat einen eineiigen Zwilling. Aber das ist bei den erweiterten Analysen nicht so. Beispiel Haarfarbe: Mit der genetischen Analyse bestimmen wir die Haarfarbe eines Menschen zwischen 15 und Anfang 20. Im weiteren Leben ändert sie sich. Und färben kann man die Haare ohnehin.
Augenfarbe ist schon besser, da kann man zwar auch manipulieren mit Kontaktlinsen, aber das kriegt man natürlich heraus. Generell lassen sich bei diesem Test aber blau und braun am besten bestimmen. Zwischentöne sind schwieriger.
Sie kriegen aber eher selten saubere Proben nur einer Person …
Das geht in der aufgeregten Debatte etwas unter. Alle Spuren, die sich aus Mischungen zusammensetzen, sind für die erweiterte DNA-Analyse kaum geeignet. Deshalb sollte man diese zunächst auf Straftaten von erheblicher Bedeutung und tatrelevante Ein-Personen-Spuren beschränken.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.