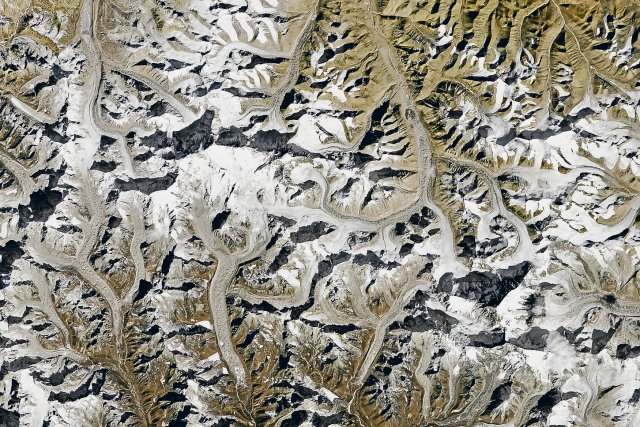Gegen Juden und Kommunisten
Jedermann sei untertan, Teil 1: Die Evangelische Kirche bis zum Ende der Weimarer Republik
Mag die Ehe von Thron und Altar auch älter sein, auf den römischen Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert zurückgehen, so war es doch Luther, der das Bündnis von geistiger und weltlicher Macht neu ordnete. Seit der Reformation war ein jeder Landesfürst (selbst wenn er, wie in Bayern, Katholik war) der Summus Episcopus - das Oberhaupt seiner evangelischen Landeskirche.
Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs sollte sich an diesem Grundprinzip deutsch-protestantischer Kirchenverfassungen nichts ändern. Warum auch? In der Obhut irdischer Obrigkeit führten die Pfarrer ein recht sorgenfreies Leben. Die Gehälter wurden pünktlich gezahlt. Im Gegenzug kümmerte sich die Pfarrerschaft darum, dass die Untertanen ordentlich getauft, verheiratet und bestattet wurden. Vor allem aber sorgten die Geistlichen für die Legitimation der Herrschaft: Ein König von Gottes Gnaden bedurfte keiner demokratischen Wahlen. Staat und Nation galten als Teil der Schöpfungsordnung, gegen die der Mensch sich nicht aufzulehnen hatte, denn: »Jedermann sei untertan der Obrigkeit … denn jede Obrigkeit ist von Gott.« (Röm 13.1)
»Schon der Anfang ist frei erfunden«, mit diesen Worten beginnt das neue Buch von Karsten Krampitz über die Irrwege und Umwege des deutschen Protestantismus im 20. Jahrhundert. Denn einen Thesenanschlag in Wittenberg, mit dem anno 1517 der Anbruch der Reformation manifest und die Papstkirche in ihren Grundfesten erschüttert wurde, hat es so nie gegeben. Der Jahrestag ist dennoch in aller Munde - für »nd« ist das Anlass für eine dreiteilige Serie, in der der Schriftsteller und Historiker Krampitz kritisch auf Etappen der Geschichte der Evangelischen Kirche in Deutschland zurückblickt.
Der Autor ist Jahrgang 1969, er hat Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaften in Berlin studiert und zum Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR promoviert. Sein neuestes Buch »Jedermann sei untertan. Deutscher Protestantismus im 20. Jahrhundert - Irrwege und Umwege«, erscheint dieser Tage im Alibri-Verlag (352 S., 20 Euro, ISBN 978-3-86569-247-4)
Mit dem Ende des Kaiserreichs fand das Kapitel Staatskirche ein Ende. Ein Ende, das aber auch ein Anfang war: »Ecclesiam habemus! Wir haben eine Kirche!«, schrieb der spätere EKD-Ratsvorsitzende Otto Dibelius in seinem im Dezember 1926 erschienenen Buch »Das Jahrhundert der Kirche«. Als Programmschrift sollte es kirchenweit für größte Aufmerksamkeit sorgen. Das Jahrhundert der Kirche, so der Kurmärkische Generalsuperintendent, hatte mit dem Jahr 1918 begonnen. »Das Ziel ist erreicht. Gott wollte eine evangelische Kirche. Seinem Willen mussten beide dienen, die aufbauen und die da zerstören wollten.«
Die Pastoren hatten mit dem Ersten Weltkrieg auch ihr Kirchenoberhaupt verloren. Was sollte jetzt werden? Aus dem Religionsunterricht an den Schulen? Oder aus den jährlichen Staatsleistungen?
Das gemeine Volk war nun der Souverän und bestimmte die Regierung. Eben diese Regierung brauchte die Kirche nicht mehr zur Legitimation. Die Sozialdemokratie strebte sogar eine Trennung von Staat und Kirche an! Dabei hatten die Kirchen ausgerechnet der verachteten »Weimarer Koalition« eine Freiheit und eine Sicherheit zu verdanken, die man bis dahin nicht kannte. Die »Novemberverbrecher« gaben der evangelischen Kirche den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und statteten sie mit dem Privileg der Steuererhebung aus. Noch dazu wurde den Pfarrern die Möglichkeit zur Seelsorge in den Bereichen Militär, Krankenhäuser und Strafanstalten eingeräumt. Im Gegenzug verzichteten SPD und Zentrum auf jede Einflussmöglichkeit des Staates in kirchlichen Fragen.
Dass die neue Demokratie die Abhängigkeit der Kirchen vom Staat beseitigt hatte, empfand man im protestantischen Milieu keinesfalls als befreiend. Anders als der Katholizismus, der als Weltkirche organisiert war und seine Angelegenheiten schon immer unabhängig vom Staat regelte, war man in der evangelischen Kirche nicht vorbereitet auf ein sich selbst organisierendes Gemeinwesen. Die seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 existierende grundsätzliche Organisationsstruktur der evangelischen Kirche in Landeskirchen blieb erhalten. Jedoch wurde 1922 der Deutsche Evangelische Kirchenbund (kurz: DEKB) zur »Wahrung und Vertretung der gemeinsamen Interessen der deutschen evangelischen Landeskirchen« gegründet.
Obwohl sich der deutsche Protestantismus 400 Jahre lang der weltlichen Obrigkeit untergeordnet hatte, die starke Bindung an Römer 13 zen-traler Bestandteil nationalprotestantischer Identität war, sollte es mit der Weimarer Republik ausgerechnet das erste demokratisch verfasste Staatswesen sein, dem die evangelische Kirche die Loyalität verweigerte. Rund acht von zehn Pfarrern trugen sich mit nationalkonservativen Wertvorstellungen. Aus ihrer Sicht war mit den Wahlen zur verfassungsgebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919 die Katastrophe eingetreten: eine Koalition aus SPD und Zentrum, aus Sozialisten und Katholiken! Als die Träger des »organisierten Vaterlandsverrats« am 28. Juni 1919 den »Schandvertrag von Versailles« unterschrieben, wandten sich die Generalsuperintendenten aller preußischen Kirchenprovinzen an ihre Gemeinden: »Das Verlangen, uns als einzig Schuldige am Kriege zu bekennen, legt uns eine Lüge in den Mund, die schamlos unser Gewissen verletzt. Als evangelische Christen erheben wir vor Gott und Menschen feierlich heiligen Protest gegen den Versuch, unserer Nation dieses Brandmal aufzudrücken. Wie man auch urteilen mag über einzelne Handlungen der Regierung unseres Kaisers: Fest steht die Reinheit seines Wollens, die Makellosigkeit seines Wandels, der Ernst seines persönlichen Christentums und seines darin tief begründeten Verantwortlichkeitsgefühls. Mit äußeren Mitteln vermögen wir ihn nicht zu schützen, aber hier unsere Bitte: Im Einklang mit Millionen deutscher Männer und Frauen rufen wir unsere Gemeinden auf, in dieser Not den Kaiser und seine schwerkranke, in den Werken christlicher Barmherzigkeit vorbildlich bewährte Gemahlin nebst unseren deutschen Führern und Helden mit dem Wall unserer Fürbitten zu umgeben (…).« Bei den Fürbitten sollte es nicht bleiben; bald schon organisierte die Kirche der Altpreußischen Union regelrechte Pilgerreisen ins niederländische Dorn, zu »Feldgottesdiensten« beim immer noch als rechtmäßig empfundenen Summus Episcopus Wilhelm II.
Die evangelische Treue zum einstigen Kaiser und preußischen König bewährte sich auch 1926 im Kampf gegen den von KPD und SPD initiierten Volksentscheid zur Enteignung der Fürstenhäuser. Der Deutsche Evangelische Kirchenausschuss erklärte hierzu: »Die geplante entschädigungslose Enteignung bedeutet die Entrechtung deutscher Volksgenossen und widerspricht klaren und unzweideutigen Grundsätzen des Evangeliums.« Von unzähligen Kanzeln wurde damals gegen den Volksentscheid gepredigt. Auch deshalb kamen am Ende nur 14 441 590 Ja-Stimmen statt der erforderlichen 20 Millionen für die Enteignung zusammen.
Zur allgemeinen Demokratieverachtung der evangelischen Kirche kam die Sorge vieler Protestanten vor sozialer Verelendung infolge der Wirtschaftskrise, aber auch eine obskure Katholikenfurcht: Während die DNVP, in gewisser Weise die Partei der Nationalprotestanten, Jahr für Jahr an politischem Gewicht verlor, bekam die Republik offenbar nur katholische Reichskanzler: Constantin Fehrenbach, Joseph Wirth, Wilhelm Marx, Heinrich Brüning und nicht zu vergessen, (der später parteilose) Franz von Papen.
Für Entsetzen sorgte aber das Gespenst des aufkommenden Bolschewismus: Der württembergische Kirchenpräsident Theophil Wurm, ein bekennender Deutschnationaler und nach 1945 erster EKD-Ratsvorsitzender, bekannte noch während der Brüning-Ära braune Farbe. Mit Blick auf den Kirchenkampf unter Stalin sagte Wurm, dass man nur die Wahl habe zwischen einer Diktatur Hitlers und einer Diktatur Moskaus und dass jedenfalls die erstere vorzuziehen sei, auch wenn sie nicht bequem sein werde. Diese Mischung aus Angst und reaktionärem Denken, verbunden mit der Illusion, mit dem Nationalsozialismus in einer Koexistenz leben zu können, ließ das protestantische Milieu zum Rekrutierungsgebiet demokratiefeindlicher Kräfte werden.
Die meisten Pfarrer begrüßten den Niedergang der parlamentarischen Demokratie und die Entwicklung hin zu einer totalitären Diktatur. Terror und Einschränkung der Grundrechte in den ersten Monaten der NS-Herrschaft übersah man oder verstand sie als notwendiges Übel bei der Rückkehr zu Sitte und Moral. Man wähnte sich in einer nationalen Revolution, in einer Übergangsepoche, die für den Einzelnen durchaus ihre Härten mit sich bringe, welche durch das hehre Ziel aber gerechtfertigt wären. Historisches Zeugnis dieser Stimmung gibt die Predigt von Otto Dibelius am 21. März 1933, dem »Tag von Potsdam«: »Wir wollen wieder sein, wozu uns Gott geschaffen hat. Wir wollen wieder Deutsche sein! […] Durch Gottes Gnade ein deutsches Volk!« Vor deutschnationalem und nationalsozialistischem Publikum erklärte der spätere EKD-Chef, ein neuer Anfang staatlicher Macht stünde immer im Zeichen der Gewalt, denn der Staat sei Macht. »Neue Entscheidungen, neue Orientierungen, Wandlungen und Umwälzungen bedeuten immer den Sieg des einen über den anderen.«
Dass es sich bei diesem Anfang um einen Abgrund handelte, um den Beginn einer faschistischen Diktatur, lag außerhalb seiner Vorstellungswelt. Hans Prolingheuer, evangelischer Publizist und verdienter Kirchenhistoriker, resümiert zum »Tag von Potsdam«: »Kein Wort der Kirche gegen die in aller Öffentlichkeit wirkenden faschistischen Mordkolonnen, die es in diesen ersten Wochen des Dritten Reiches den ›Novemberverbrechern‹ schon heimzahlen! Kein Wort der Kirche gegen die Verschleppung von Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftern in die ersten Konzentrationslager! Kein Wort der Kirche gegen die öffentlichen Ausschreitungen gegen die Juden!«
Wie so viele Repräsentanten des deutschen Protestantismus vertrat auch Otto Dibelius die Ansicht, dass dem angeblich übermäßigen Einfluss des Judentums auf Staat und Gesellschaft Einhalt geboten werden müsse. Mit Dibelius war es, wie es der Historiker Saul Friedländer schreibt, der damals prominenteste evangelische Geistliche in Deutschland, der am 4. April 1933 in einer Rundfunkrede, die in den USA ausgestrahlt wurde, das NS-Regime verteidigte, die Brutalitäten in den Konzentrationslagern bestritt und allen Ernstes behauptete, der staatlich organisierte Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte wäre ein Akt berechtigter Notwehr gewesen, der »in absoluter Ruhe und Ordnung verlaufen« sei.
Gemeinsam mit dem amerikanischen Methodistenbischof John Louis Nuelson hatte Dibelius in jenen Tagen den gefolterten KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann im Gefängnis besucht. Jedoch nicht im Sinne des Evangeliums, Matthäus 25, Vers 36: »Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen« - Thälmann war nicht der Geringste unter den Brüdern Jesu, sondern ein bolschewistischer Umstürzler. In seiner Rundfunkrede verkündete Dibelius dann: »Wir haben die kommunistischen Führer im Gefängnis besucht. (…) An den Schauernachrichten über grausame und blutige Behandlung der Kommunisten in Deutschland ist kein wahres Wort.«
Historiker schätzen die Zahl der bis zu diesem Zeitpunkt durch SA und SS Ermordeten auf 500 bis 600 Menschen. Mindestens 50 000 waren bereits in Konzentrationslagern eingesperrt. Otto Dibelius nahm also Mord und Terror billigend in Kauf; in den Lagern waren eh nur Leute, die man in der Kirche oft genug zum Teufel gewünscht hat: Kommunisten, Sozialisten, Asoziale.
Im selben Monat schrieb Dibelius, damals noch Generalsuperintendent der Kurmark, in einem Rundbrief an die brandenburgischen Pfarrer: »Meine lieben Brüder! Für die letzten Motive, aus denen die völkische Bewegung hervorgegangen ist, werden wir alle nicht nur Verständnis, sondern volle Sympathie haben. Ich habe mich trotz des bösen Klanges, den das Wort vielfach angenommen hat, immer als Antisemiten gewusst. Man kann nicht verkennen, dass bei allen zersetzenden Erscheinungen der modernen Zivilisation das Judentum eine führende Rolle spielt.«
Zwar fand Otto Dibelius kurze Zeit später den Weg in die Bekennende Kirche und prägte diese entscheidend mit, ein öffentliches Eintreten seinerseits für die verfolgten Juden ist jedoch nicht bekannt. Der spätere EKD-Ratsvorsitzende trat auch nicht für die Protestanten ein, die durch die Rassegesetze der Nazis zu »Nichtariern« erklärt wurden. Der Pfarrernotbund kämpfte in jenen Tagen für die 115 Pfarrer in Deutschland, denen man eine jüdische Herkunft nachgewiesen hatte - aus Sicht von Otto Dibelius, Martin Niemöller und anderen Bekenntnispfarrern mit Erfolg. Nur: Die evangelische Gemeinde, die sich im Ghetto Theresienstadt im Untergrund zusammenfinden sollte, umfasste zeitweilig bis zu 3000 Protestanten jüdischer Herkunft! Die Gruppe derer, die selbst oder deren Vorfahren vom Judentum zum Christentum konvertiert waren bzw. die als Ehepartner mit Menschen jüdischer Herkunft verbunden waren, belief sich in Deutschland 1933 auf rund 400 000 Personen. Wie viele »nichtarische« Protestanten in den Vernichtungslagern umkamen, kann heute nicht gesagt werden. Fest steht, dass diese Menschen für die Nazis gar nicht ermittelbar gewesen wären, ohne die Hilfe der Kirchen, die den Nazis allerorten Einblick in die Kirchenbücher gewährten.
Nächste Folge: Frömmelnde Rückbesinnung - wie die evangelische Kirche zu ihrer NS-Verstrickung schwieg.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.