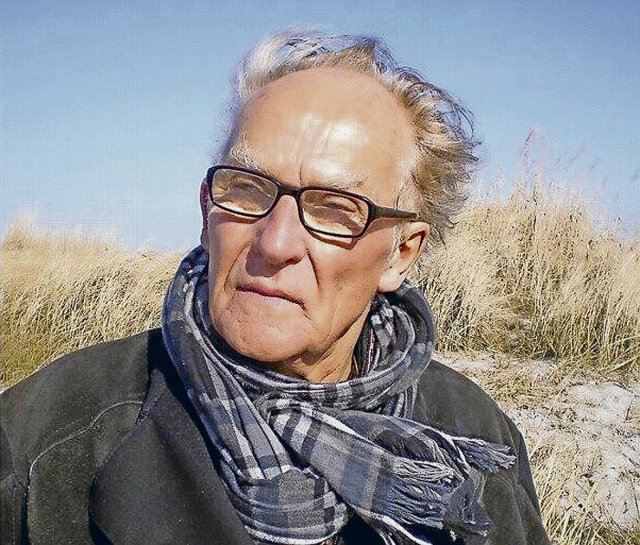Wer Glück hat, besitzt einen Höhlengott
»Die Höhle« von Jewgeni Samjatin: Seine Erzählungen (1920 - 1928) können einem den Atem nehmen
Kürzlich fällt mir ein altes Reclamheft mit der Erzählung »Die Höhle« des russischen Schriftstellers Jewgeni Samjatin (1884 - 1937) in die Hände. »Die Höhle« ist eine dunkle, mit Symbolbildern und -gestalten angereicherte Erzählung. Es ist eine Schilderung, die von den ersten Sätzen an fesselt und zugleich frösteln, nein, frieren lässt. Eigentlich ist es nur eine bitter-realistische Alltagsgeschichte aus dem Petersburger Hungerwinter 1919/20 (»man muss die Zähne zusammenbeißen, damit sie nicht klappern«). Es ist eine Geschichte, wie sie sich damals in den russischen Städten und später vielfach zutrug, die sich tausendfach wiederholt - in Moskau, Petersburg, Leningrad, Berlin, Donezk, Aleppo, Mossul, Kirkuk … Aber das ist es wohl gerade, was unter die Haut geht: diese Zeitlosigkeit im Konkreten, dieses sich immer wieder Wiederholende.
Die einfache, fast lakonische Sprache ist betörend. Tief hängt ein »löchriger Wattehimmel« über der Stadt, die einmal eine war und nun nur noch eine Höhlenlandschaft ist. Durch die Löcher weht es eiskalt, in den Höhlen wohnen die Menschen, und wenn sie Glück haben, dann haben sie in ihrer Stube einen »Höhlengott«, einen kleinen gusseisernen Ofen, in dem sie das letzte Stuhlbein oder wertvolle Bücher verbrennen können, derweil sich draußen ein Urtier, ein Riesen-Mammut, seine Opfer sucht … Als »Die Höhle« 1922 erschien, galt die Erzählung als Meisterwerk. Dann wurde sie aus den russischen Bibliotheken (samt anderen Werken Samjatins) entfernt.
Ich lese mich fest, hole mir meine Samjatin-Ausgabe aus dem Bücherschrank: vier Paperback-Bände im Schuber, 1991 vom Kiepenheuer Verlag Leipzig und Weimar herausgegeben, mit einem Nachwort, aus dem man viel über den russischen, 1931 nach Paris emigrierten Schriftsteller und seinen ins Getriebe damaliger Zeitläufe verflochtenen Lebensweg erfährt. Unter den Erzählungen 1917 bis 1928 finde ich auch »Die Höhle«.
Jewgeni Samjatin war in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts eine Entdeckung, gleich anderen, lange in ihrer russischen Heimat verschwiegenen »schädlichen« Schriftstellern und ihren Werken (wie auch »Die Baugrube« von Andrej Platonow). Diese Samjatin-Ausgabe ist ein Kleinod, zumindest so lange, bis auch der ganze phantastische Erzähler wieder neu zugänglich gemacht wird.
Das ist über kurz oder lang zu erwarten, fügen sich seine Werke doch den wiederentdeckten Werken von russischen Exilschriftstellern des 20. Jahrhunderts nahtlos und fast zeitgleich hinzu, von Ossorgin, Sawinkow, Gasdanow usw. Man fragt sich, warum gab es überhaupt wieder diese mehr als zwanzigjährige Lücke in der Wahrnehmung Samjatins? Erhältlich ist im Buchhandel nur der Roman »Wir«, eine Anti-Utopie und Parodie eines künftigen Überwachungs- und »Ameisen«-Staates, offensichtlich eine Vorlage für Orwells »1984«. »Wir« ist auch in Russland heute noch das bekannteste Werk Samjatins, mir aber doch fremd, am besten historisch einzuordnen.
Sind die frühen Erzählungen zumeist Provinzsatiren in der Tradition von Leskow und Gogol, so haben die späteren, nach 1918 geschriebenen eine wesentlich stärkere Aussagekraft. Der Gegensatz zwischen Anspruch und Wirklichkeit verleiht ihnen diese Intensität. Jewgeni Samjatin, wie Ilja Ehrenburg, Alexander Blok und so viele andere, ein Verfechter des künstlerischen Neuanfangs nach der Revolution, sah bald die Realität sozialer, politischer und menschlicher Widersprüchlichkeiten. Vom Tod Bloks 1921 tief erschüttert, verfasste er einen »Nekrolog«, in dem es heißt, an seinem Tod sei »das grausame Höhlenleben in Petrograd« schuld. »Die Höhle« ist eine Illustration dazu.
In der Erzählung »Der Drache« (1918) tötet ein Rotarmist skrupellos einen Intellektuellen und haucht zugleich einem halberfrorenen Spatzen wieder Leben ein. Das Widersprüchliche im Menschen steigert sich ins Absurde. Das frostklirrende Petersburg »glüht im Fieberwahn«, und »knirschend rasten die Straßenbahnen aus der irdischen Welt fort ins Unbekannte«.
Ein vielfaches Antlitz hat die Welt in der »Erzählung vom Allerwichtigsten« (1923). Sie ist ein Fliederstrauß, sie ist ein Spiegel des Flusses, und sie ist ein dunkler Stern mit »zerstörten Mauern, Galerien, Maschinen, drei erfrorenen Leichen ...«. Der »Höhlenmensch« Martin liebt Bücher und die Musik Skrjabins, und er wird in größter Not zum Dieb, bevor er seine sterbende Frau mit einem Giftfläschchen »erlöst«.
»Rings um die Wassili-Insel lag wie ein weites Meer die Welt - dort war der Krieg, dann die Revolution. Im Kesselhaus bei Trofim Iwanytsch aber sang wie eh und je dumpf der Kessel … Nur die Kohle kam jetzt … aus Donezk. Diese bröckelte, der schwarze Staub kroch überallhin und ließ sich mit nichts abwischen. Und derselbe schwarze Staub schien auch zu Hause unmerklich alles bedeckt zu haben. Nach außen hatte sich nichts geändert - und trotzdem stimmte etwas nicht …«
So heißt es in »Hochwasser« von 1928. Noch machen Krieg und Revolution einen Bogen um die Wassili-Insel, auf der Trofim und Sofja leben, aber dann steigt das Wasser unaufhaltsam im doppelten Sinn.
Samjatin schrieb in den »Erinnerungen an Alexander Blok« (Friedenauer Presse, 2011), der Dichter sei »an Luftmangel« gestorben. Die Erzählungen können einem den Atem nehmen. Sein Petersburg/Leningrad mit der düsteren Szenerie von Armut, Hunger und Verlust an Menschlichkeit ist ein Pendant zu Michail Ossorgins Moskau.
Wie Ossorgin am Beispiel einer kleinen Straße das sterbende Moskau heraufbeschwört, so Samjatin in der Erzählung »Die Rus« (1923) noch einmal blaue Wintertage und das Gold des Sommers. »Aus rosigem Gold die Kreuze über den blauen Kuppeln, rosig die Steine, das Glas in den Fenstern, die Zäune, das Wasser. Und alles wie gestern. Nichts ist geschehen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.