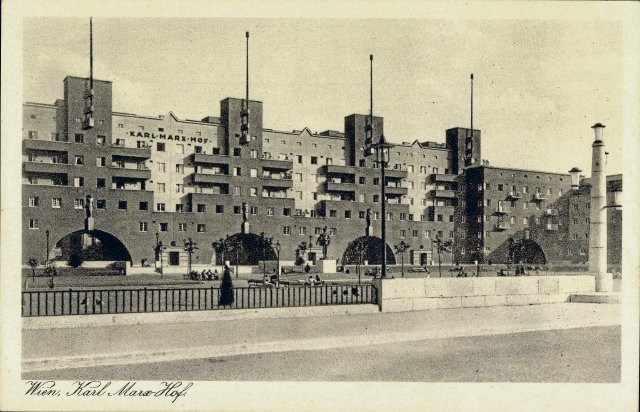- Wissen
- Gewässerökologie
Die Erfinder des »Tomatenfischs«
Am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei wird auch Anwendungsforschung betrieben
Das IGB macht nicht nur ökologische Grundlagenforschung. Es ist auch in der Anwendungsforschung, der Politikberatung und der Umweltbildung aktiv. Ein wichtiger Fingerzeig in Richtung Politik ist die im Mai von der Nationalakademie Leopoldina vorgelegte Denkschrift »Der stumme Frühling« für einen umweltverträglichen Pflanzenschutz, an der IGB-Direktor Mark Gessner für den Gewässerteil mitgewirkt hatte. Zentrale Aussage: »Pestizide können gerade in Gewässern große Probleme verursachen.« So lägen der Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide, die auch für das Bienensterben verantwortlich seien, »im Grundwasser und in Gewässern durch Oberflächenabfluss und Kläranlagen in ökologisch wirksamen Konzentrationen vor, obwohl dies durch die Zulassung ausgeschlossen werden sollte«. Hier müsse die Umweltpolitik dringend handeln.
Seinen größten Erfolg beim Wissenstranstransfer in die wirtschaftliche Praxis hatte das IGB beim Projekt »Tomatenfisch«: Gemeint ist die gemeinsame Treibhauszucht von Gemüse und Fischen, die »Aquaponik« genannt wird. Auf die Technologie, so IGB-Wissenschaftler Werner Kloas, sei man 2007 bei einem institutsinternen »Kaffeekränzchen« gekommen, als überlegt wurde, wie in Deutschland eine nachhaltige Aquakultur gefördert werden könnte. »Auf einmal erzählte unser Kollege Bernhard Rennert, er habe schon zu DDR-Zeiten am damaligen Institut für Binnenfischerei zusammen mit der Akademie für Landwirtschaftswissenschaften in Großbeeren eine Aquaponikanlage entwickelt, in der Karpfen und Gurken gemeinsam gezogen wurden«, erinnert sich Kloas. Das Verfahren wurde wieder aufgegriffen, diesmal mit »Nil-Tilapia«, einem robusten Allesfresser, und Tomaten als beliebtestem Gemüse. Inzwischen findet das Verfahren unter dem Stichwort »Urban Farming« - der Lebensmittelproduktion in der Stadt - in Deutschland schnelle Verbreitung.
Auch Umweltbildung ist für die »Binnenfischer« des IGB ein Thema. Vorige Woche erschien ihre jüngste Untersuchung über das »Fischwissen« der Deutschen. Bachforelle, Äsche, Barbe, Brachse und Kaulbarsch - schon mal gehört? Das Ergebnis: Die Befragten kennen nur wenige Fischarten, eine gute ökologische Qualität der Flüsse ist ihnen dennoch sehr wichtig. »Unsere Annahme, dass das Wissen über Süßwasserfische in der deutschen Bevölkerung eher begrenzt ist, hat sich in unserer Studie bestätigt«, erklärt die Autorin Sophia Kochalski. »Regenbogenforelle und Bachsaibling, die im 19. Jahrhundert aus Nordamerika eingeführt wurden, werden überwiegend für heimisch gehalten, der einst heimische Atlantische Lachs hingegen von den Deutschen vornehmlich in Skandinavien und nicht mehr hierzulande verortet, was uns überrascht hat.«
Das Licht, dessen Umweltwirkung die IGB-Forscher im Stechlinsee untersuchen, hat sie auch künstlerisch in den Bann geschlagen. Derzeit zeigt das Institut zusammen mit der Künstlerin Jenny Brockmann in der Kleinen Orangerie in Berlin-Charlottenburg die Installation »Of Colour and Light«. Herzstück der Ausstellung sind sechs große Tanks mit Spreewasser, die mit unterschiedlich farbigem Licht beschienen werden. Besucher können Wasserproben aus den Behältern entnehmen und untersuchen. Das Experiment will »individuell erfahrbar machen, wie sich künstliches Licht im Laufe der Zeit auf verschiedene Lebewesen im (und am) Fluss auswirkt.« MRo
Die Ausstellung ist bis zum 2. September in der Kleinen Orangerie in Berlin-Charlottenburg zu sehen (Di bis So, 12-18 Uhr, Eintritt frei).
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.