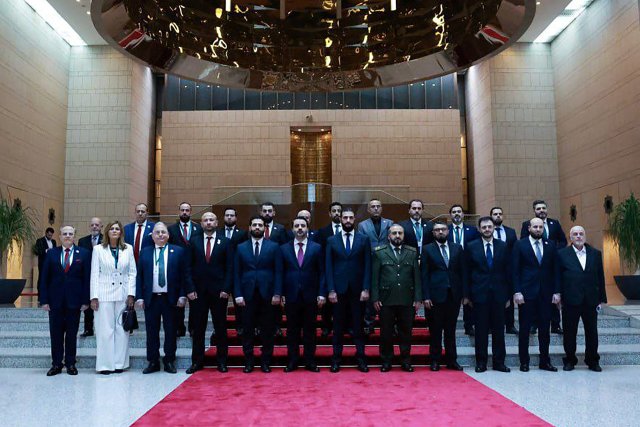- Politik
- Coronakrise im Globalen Süden
Lockdown für Lebensmittel
Wie sich die Coronakrise auf die Versorgung im Globalen Süden auswirkt.
Die Covid-19-Pandemie betrifft nicht nur die öffentliche Gesundheit, sondern bedroht auch die globale Ernährungssicherheit.« Mit diesen Worten eröffnete der Generalsekretär der UN-Ernährungsorganisation (FAO), Qu Dongyu, das Treffen der G20-Agrarminister*innen vor zwei Wochen. Bis Ende des Jahres könnte sich die Zahl hungernder Menschen verdoppeln, befürchtet die FAO. Allein in Westafrika könnte nach Angaben der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS die Zahl derer, die von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung bedroht sind, zwischen Juni und August dieses Jahres von 17 Millionen auf 50 Millionen Menschen steigen.
Auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) befürchtet eine Hungerkrise. 150 Millionen Euro will sein Ministerium umschichten und zudem ein Corona-Soforthilfeprogramm von einer Milliarde Euro auflegen. »Darin stellen wir jeden fünften Euro für die Hungerbekämpfung bereit«, erklärte Müller am Dienstag. Vor allem Krisenregionen seien betroffen, warnt die Welthungerhilfe. »Bleibt die internationale Staatengemeinschaft untätig, besteht die große Gefahr, dass das verhängnisvolle Zusammenspiel aus Corona-Pandemie, bewaffneten Konflikten und Klimawandel zu einer Hungerkatastrophe größten Ausmaßes führt«, sagte deren Präsidentin Marlehn Thieme.
135 Millionen Menschen in 55 Ländern litten Ende 2019 an Hunger. Das geht aus einem aktuellen Bericht des Global Network Against Food Crises hervor. Mehr als die Hälfte (73 Millionen) von ihnen lebt in Afrika; 43 Millionen im Nahen Osten und in Asien; 18,5 Millionen in Lateinamerika und der Karibik.
Die häufigsten Ursachen für Hungerkrisen sind bewaffnete Konflikte, von denen 77 Millionen Menschen betroffen sind. 34 Millionen leiden Hunger infolge von Wetterextremen. Wirtschaftliche Krisen führen für 24 Millionen Menschen zu ungenügender Lebensmittelversorgung. Damit stieg die Zahl nach einer längeren Phase seit 2016 wieder. Dieser Negativtrend wird durch die Corona-Pandemie deutlich verstärkt. had
Dabei ist die Lage anders als bei der Ernährungskrise 2008, als Ernteausfälle, geringe Lagerbestände und massive Spekulationen zu exorbitant hohen Preisen führten. In Corona-Zeiten geht es in erster Linie um den Zugang. »Heute gibt es genug Lebensmittel für alle, aber sie erreichen die Menschen nicht oder die haben kein Geld, um sich Lebensmittel kaufen zu können«, erklärte Agrarexpertin Marita Wiggerthale von der Entwicklungsorganisation Oxfam dem »nd«.
Eine weitere Folge der Grenzschließungen und Ausgangssperren: »Bäuerliche Produzent*innen bleiben auf ihren Lebensmitteln sitzen«, so Wiggerthale. Besonders dramatisch sei die Situation bei verderblichem Gemüse. Das Center for Sustainable Agriculture in Indien berichtet, dass die Einnahmen der Gemüseproduzent*innen im Vergleich zu 2019 um die Hälfte eingebrochen sind. Aus Togo sei bekannt, dass kleinbäuerliche Produzenten*innen für einen 50 Kilogramm Sack Avocados 33 Prozent weniger als üblich bekämen.
Andere Preise wiederum steigen. In Westafrika sind auf den meisten Märkten höhere Getreidepreise zu verzeichnen: In Ghana stiegen die Preise für Reis und Hirse um 20 bis 33 Prozent, in Burkina Faso kosteten 100 Kilogramm Hirse innerhalb weniger Tage rund 4,50 Euro mehr. Preistreibend könnten sich zudem Exportbeschränkungen auswirken. Bisher sei das nur selten der Fall, so Wiggerthale, aber die Entwicklung könne sich ändern. So hat Russland am Dienstag angekündigt, die Exporte von Weizen sowie Roggen, Gerste und Körnermais zu stoppen, um die Getreidepreise zu stabilisieren und die Deckung des Binnenbedarfs zu gewährleisten. »Die aktuellen Preisschwankungen bilden den Nährboden für die exzessive Spekulation mit Nahrungsmitteln«, befürchtet Wiggerthale.
Ausgangssperren und die Abriegelung ganzer Ortschaften führen zudem dazu, dass Menschen sich nicht mehr versorgen können. So wurden in Senegal wichtige Verkehrsverbindungen zu lokalen Märkten gekappt. In Kenia und Nigeria führte der »Lockdown« zu Unruhen, weil Ausgangssperren es einerseits unmöglich machen, einkaufen zu gehen, andererseits die Versorgung mit Lebensmitteln durch Regierung und Hilfsorganisationen unzureichend ist. Hinzu kommt, je größer der informelle Sektor, desto weniger Möglichkeiten gibt es für die Menschen, Vorräte anzulegen - Essen wird von Tag zu Tag gekauft. »Betroffen sind all jene, die ohnehin am Rande der Existenz leben, wenig Geld verdienen und keinen finanziellen Puffer haben: Marktverkäufer*innen, Tagelöhner*innen, Plantagenarbeiter*innen, Migrant*innen, kleinbäuerliche Produzent*innen und nomadische Viehzüchter*innen«, sagt Wiggerthale.
»Die Covid-19-Pandemie erschüttert weltweit die städtischen Ernährungssysteme und stellt Städte und Kommunalverwaltungen vor eine Reihe von Herausforderungen«, erklärt auch die FAO. Lebensmittel müssten aber weiterhin erschwinglich, zugänglich und verfügbar sein, um eine Hungerkrise zu vermeiden. FAO-Generalsekretär Qu Dongyu mahnte deshalb eine Überprüfung der Grenzpolitik an und forderte Maßnahmen, »die nicht zu Unterbrechungen in der Versorgungskette führen«. Zudem müssten Kleinbäuer*innen, die sowohl für ihre Haushalte als auch für lokale Märkte produzierten, weiterhin Zugang zu Saatgut und Düngemitteln haben.
Mit einer Reihe von Vorschlägen wollen die FAO und die Afrikanische Union insbesondere die lokalen Produzent*innen stützen. »Aufbauend auf den Lehren aus der Reaktion auf die Ebola-Virus-Krankheit in Westafrika, wo Erzeugerorganisationen existieren und funktionieren, sollen diese unterstützt werden, damit sie Vorräte einkaufen können, Zugang zu Transportmitteln haben, um Lieferungen zu transportieren und Lagereinrichtungen nutzen können, um die Lebensmittel so nah wie möglich an die lokale Ebene zu bringen«, heißt es im Maßnahmenkatalog, der Mitte April von der FAO und allen 55 Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Union verabschiedet wurde. Zudem sollten informelle Liefersysteme auf lokaler Ebene genutzt werden, um die ländlichen Gebiete zu versorgen.
Auch Organisationen von Kleinbäuer*innen setzen auf Unterstützung der lokalen Versorgung. Sie fordern alle Staaten auf, die Preise stabil zu halten, die Versorgung mit Lebensmitteln aus Familienbetrieben sicherzustellen und den grenzüberschreitenden Warenverkehr zu gewährleisten. Ibrahima Coulibaly, Präsident des Netzwerks der Bauern- und Erzeugerorganisationen Westafrikas (ROPPA), erklärt: »Wir hoffen, dass politische Entscheidungsträger und Bürger sich der Notwendigkeit bewusst werden, die lokale Produktion und den lokalen Verbrauch zu fördern. Das ist heute wichtiger denn je.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.