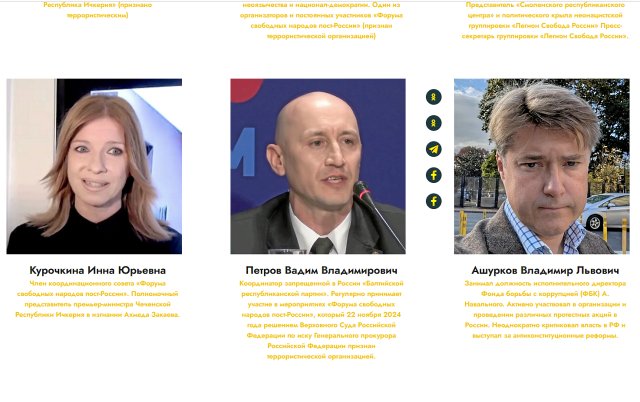- Politik
- Adoptionsrecht
Diskriminierung als Nebensache
Bundesrat verhinderte weitere Verschlechterung des Adoptionsrechts lesbischer Mütter
Mama, Papa, Kind - so ist auch heute noch die Vorstellung vieler Menschen von einer »normalen« Familie. Auch bei politischen Entscheidungen zeigt sich immer wieder, dass nur diese Form von Familie mitgedacht wird. So auch Ende Mai passiert, als der Bundestag den Entwurf des Justizministeriums für ein Adoptionshilfegesetz mit den Stimmen der Großen Koalition annahm. Das Gesetz soll »das Gelingen von Adoptionen fördern und damit das Wohl der Kinder sichern«. Linkspartei und Grüne enthielten sich - sie kritisierten den Entwurf als »Entwürdigung« von lesbischen Müttern.
In dem Gesetz sollte nämlich auch die sogenannte Stiefkindadoption neu geregelt werden. Diese ist für Zwei-Mütter-Familien bisher die einzige Möglichkeit für eine gemeinsame rechtliche Elternschaft und die damit verbundene Absicherung. Wenn ein lesbisches Pärchen ein Kind bekommt, wird nur die leibliche Mutter als Elternteil anerkannt. Die Partnerin muss den Nachwuchs erst als Stiefkind adoptieren. Dazu gehört ein monatelanger Weg: Die Frau muss sich vor den Behörden als geeignete Mutter beweisen, für die Eltern ein enorm belastender und diskriminierender Aufwand.
Durch das neue Gesetz sollte noch eine verpflichtende Beratung für die Stiefkindadoption eingeführt werden. Betroffene kritisierten dies. Die Neuregelung führe zu noch längeren Wartezeiten, bis der Adoptionsantrag gestellt werden könne. »Bei Zwei-Mütter-Familien werden die Kinder als Wunschkinder in die Partnerschaften der Frauen hineingeboren«, es gebe daher eine gänzlich andere Ausgangslage als bei anderen Stiefkindadoptionen, kritisierte der Lesben- und Schwulenverband. Er startete eine Petition gegen das Gesetz, die von über 66 000 Menschen unterschrieben wurde.
Am Freitag stimmte nun auch der Bundesrat über das Adoptionshilfegesetz ab. Manfred Lucha (Grüne), Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, kritisierte in der Sitzung: Wenn in heterosexuellen Ehen ein Kind geboren werde, sei der Ehemann unabhängig von biologischer Elternschaft rechtlich der Vater. »Niemand käme auf die Idee, ihn vorher zu einer Adoptionsvermittlungsstelle zu schicken und einen Beratungsschein zur Voraussetzung der Vaterschaft zu machen.« Bei einer Zwei-Mütter-Ehe würden jedoch die finanziellen Verhältnisse, Gesundheit, Führungszeugnis und vieles weitere überprüft. Dies sei diskriminierend und passe nicht zu den Erfolgen der letzten Jahre wie etwa die Ehe für alle.
Vor der Bundestagsabstimmung hatte es in den Ausschüssen des Bundesrates einen Antrag auf Einberufung des Vermittlungsausschusses gegeben. Es wurde ein Gesetzentwurf formuliert, der eine entsprechende Ausnahmeregelung formuliert hatte. Die Bundesregierung ist darauf jedoch nur mit einer Protokollerklärung eingegangen, in der sie eine Ausnahmeregelung zusagte.
Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte am Freitag im Bundesrat, eine bloße Ankündigung von Änderungen reiche nicht aus. Dies würde bedeuten, erst einmal ein diskriminierendes Gesetz zu beschließen. Zudem sei unsicher, ob es für die Ausnahmeregelung im Bundestag überhaupt eine Mehrheit gebe.
Während vor allem die Union die verschärfte Stiefkindadoption fordert, beharrte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) darauf, das Adoptionshilfegesetz, so wie es im Bundestag beschlossen wurde, einzuführen. »Wir werden die andere Frage lösen«, sagte sie zu der Passage, die lesbische Mütter diskriminiert.
Letztlich kam im Bundesrat aber keine Mehrheit für das Gesetz zustande. Gabriela Lünsmann vom Lesben- und Schwulenverband äußerte sich erleichtert darüber. Sie kritisierte aber auch: Es sei »absolut unverständlich, warum das Bundesfamilienministerium überhaupt an der verschärfenden Regulierung im Gesetz festgehalten hat«. Die rechte lesbischer Mütter sind mehr als eine nebensächliche »andere Frage«.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.