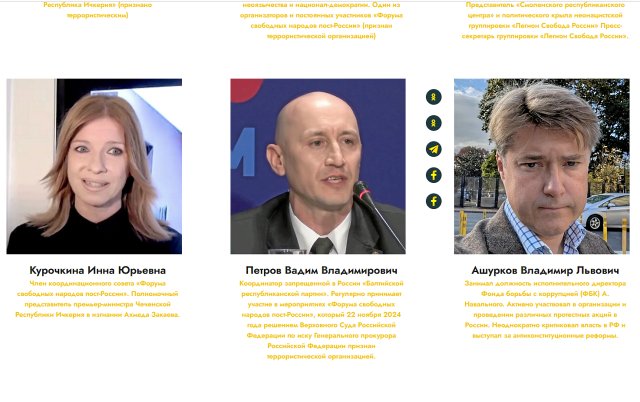- Politik
- Vier-Tage-Arbeitswoche
Wenig Aufgeschlossenheit
Kritik an Vorschlag von Linke-Chefin zur Vier-Tage-Arbeitswoche
Seit Dienstag wird in der Bundesrepublik endlich wieder über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Auslöser der Debatte ist ein Vorschlag von Linke-Chefin Katja Kipping. Sie hatte in einem Interview dafür geworben, das Corona-Kurzarbeitergeld als Anschubfinanzierung für eine flächendeckende Vier-Tage-Arbeitswoche für Beschäftigte in der Bundesrepublik zu nutzen.
Die Idee: Unternehmen, die die Arbeitszeit entsprechend verkürzen, sollten noch für ein Jahr einen Lohnkostenzuschuss bekommen. Danach brauche es einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung über eine Vier-Tage-Woche oder eine Höchstarbeitszeit von 30 Stunden ohne weitere staatliche Kofinanzierung. Gegenüber der Wirtschaft argumentierte Kipping, eine derart reduzierte Arbeitszeit mache die Beschäftigten »glücklicher, gesünder und produktiver«. Somit würden auch die Unternehmen davon profitieren, denn die Mitarbeiter machten dann weniger Fehler, seien motivierter und würden seltener krank.
Gerade die Coronakrise sei ein »guter Zeitpunkt, um damit anzufangen, findet die Politikerin.« Zudem könne eine Vier-Tage-Woche für mehr Gleichberechtigung sorgen, weil sich Paare seltener entscheiden müssten, wer für die Kinder kürzertrete. Die Linkspartei fordert seit Jahren - auch mit Blick auf die zunehmende Automatisierung vieler Arbeitsbereiche und den damit verbundenen Wegfall von Jobs - ein »neues Normalarbeitsverhältnis« mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von etwa 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich zur aktuellen Arbeitszeit.
Die meisten Reaktionen auf Kippings Vorstoß lassen sich so zusammenfassen: Ganz charmant, aber utopisch und nicht umsetzbar, zudem stünden die geltenden Gesetze dem entgegen. Holger Schäfer, Arbeitsmarktexperte am unternehmernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, wies die Idee erwartungsgemäß zurück. Damit werde die coronabedingte Krise »zum Dauerzustand«, sagte Schäfer am Mittwoch im Deutschlandfunk. Weniger zu arbeiten, führe zu weniger Produktion und Steuereinnahmen. Genau das mache eine Wirtschaftskrise aus, und es sei gefährlich, diesen Zustand staatlich zu fördern.
Skeptisch zeigen sich aber auch Gewerkschaftsvertreter. So begrüßte Markus Schlimbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen, den Vorstoß zwar grundsätzlich. Doch gerade in kleineren Betrieben könne die »Arbeitsverdichtung sich auf vier Tage konzentrieren«, warnte er gegenüber dem MDR.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.