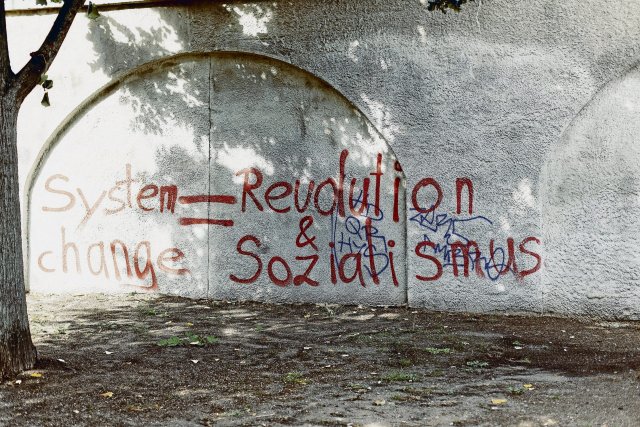- Kultur
- »Der Jahrhundertraub«
Die guten Bösen
Die kolumbianische Serie »Der Jahrhundertraub« ist die fiktionale Version eines realen Verbrechens
Die Bösen, da sind sich Filmemacher und ihre Kundschaft einig, sind oft genau das und sehen auch noch gerne so aus, böse eben. Ob nun wesensmäßig wie der Serienmörder Hannibal Lecter oder triebhaft wie sein Jagdobjekt Buffalo Bill, schillernd abgründig wie Tarantinos Kuriositätenkabinette oder nur abgründig wie im Subgenre Torture Porn, etwa bei »Hostel« oder »Saw«: Wenn Menschen in Film und Fernsehen so brutal vom Pfad der Humanität abweichen, dass es Blut, Blei und Tote hagelt, sind die Sympathien meist auf Seiten der Opfer. Mit einer Ausnahme: Raubüberfälle.
Seit es Juwelendiebe im schwarz-weißen Meisterwerk »Rififi« 1955 zu Publikumslieblingen gebracht haben, schlägt das Herz der Zuschauer zusehends für Gesetzesbrecher - was zwölf Jahre später darin gipfelte, dass »Bonnie und Clyde« trotz Dutzender Leichen am Fluchtwegrand von Faye Dunaway und Warren Beatty Popstars wurden. Ein Status, den Brad Pitt und George Clooney Anfang des neuen Jahrhunderts im Remake von Frank Sinatras Casino-Coup »Ocean’s Eleven« (»Frankie und seine Spießgesellen«) buchstäblich spielend wiederholten.
Wie verwerflich eine Straftat ist, kommt halt auch auf ihr Opfer an. Sofern es nämlich windig, reich oder beides genug ist, während Täter wie das legendäre Rat Pack auf charmante Art desperat sind, skalieren die Heist-Movie genannten Fischzüge den zivilisatorischen Kompass kurz mal um. Nur so ist zu erklären, dass man sich innerlich sofort mit sechs Safeknackern verbrüdert, die ab heute bei Netflix den größten Banküberfall der kolumbianischen Geschichte nachstellen: »El robo del siglo« (»Der Jahrhundertraub«) ist die fiktionale Version eines realen Verbrechens, mit dem die örtliche Nationalbank 1994 um 33 Millionen Dollar erleichtert wurde. Und dass die Showrunner Camilo Prince und Pablo González den Tathergang wie ihr Kollege Jules Dassin in »Rififi« fast auf Echtzeit dehnen, macht nur einen Teil der Faszination dieses Heist-Movies aus. Noch interessanter dürfte es sein, wie sich Andrés Parra - der bereits den Drogenboss Pablo Escobar gespielt hatte - als Bandenführer Chayo mit sechs Tonnen Bargeld durch ein medial aufgeputschtes Land schlagen muss.
Dürfte. Konjunktiv. Denn wie so oft weigert sich der Streamingdienst in seiner Marktführermischung aus Zwangsneurose und Medienverachtung, Journalisten vorab Bewegtbilder zu zeigen. Inhaltlich lässt sich die Serie also nur anhand offizieller und geleakter Ausschnitte bewerten. Ihnen zufolge wirkt der nostalgische Look angenehm authentisch, die Besetzung unprätentiös, das Erzähltempo variabel. Ob all dies von Anfang bis Ende sehenswert bleibt, wird erst der Serienstart am Freitag zeigen. Auch ohne Ansichtsmaterial aber reiht sich »El robo del siglo« in die Liste jener Filmdelikte ein, die unser moralisches Grundgerüst fiktional unterwandern.
Während das Böse mit Stoppelbart zum Gaunerblick schon optisch unverkennbar die herrschende Moral untergrub (und es im Kinderprogramm noch tut), hat der anhaltende Verlust von Religiosität, Wertemodellen, natürlicher Autorität auch die Trennlinien zum Guten verwischt. Die Säkularisierung hat aus Sicht des Medienexperten Alexander Grau so einen »Raum geschaffen, das Böse in seiner Schönheit und Verführungskraft darzustellen«. Selbst Vampire können nun zuckersüße Lover sein. Erfolgt die Ästhetisierung aber im Führerbunker oder wie zuletzt bei Batmans boshaftem Feind Joker, muss sie mangels amoralischer Gegenseite scheitern.
Kriminelle wie Frankies Spießgesellen dagegen erleichtern nur die Gewinner eines kapitalistischen Selbstbereicherungssystems um einen Bruchteil ihrer Profite. Es verdient seine Abreibung also ähnlich wie der kolumbianische Polizeistaat, in dem die gestohlenen 33 Millionen wohl ohnehin nur von unten nach oben verteilt würden. »Alle Menschen lieben Helden«, schreibt Andrea Freitag im Sachbuch »Schurkisch!«. Aber das »Spektakel des Schurken, der in unsere Welt einbricht, ist meistens doch viel spannender«. Und in diesem Fall auch ritterlicher. Trotz aller Gewalt. Und ein bisschen auch wegen ihr.
Ab 14.8. über Netflix
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.