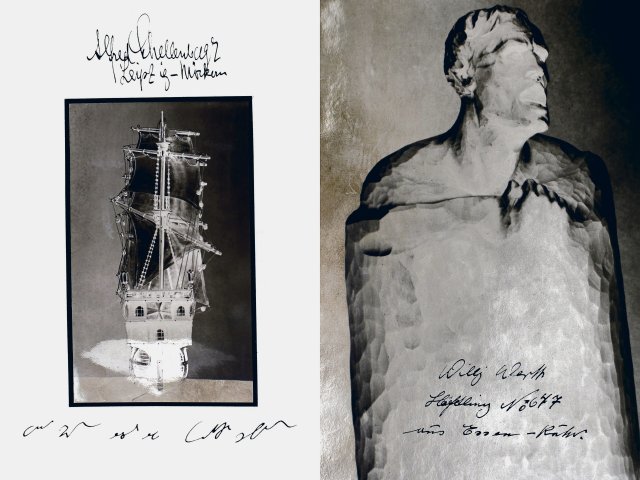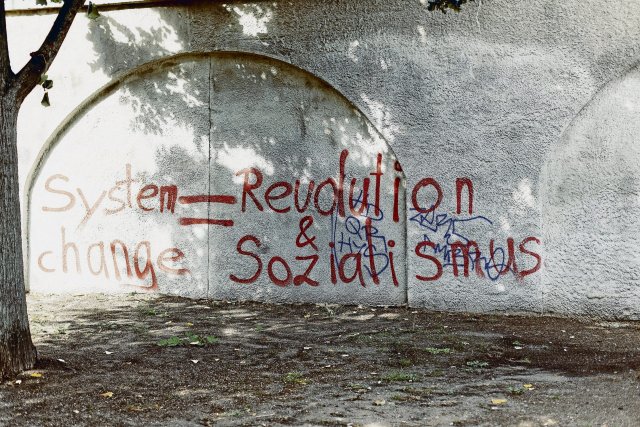Leichen im Keller der Politik
Im Politthriller »Roadkill« spielt Hugh Laurie einen ehrlich verlogenen Minister mit Hang zur transparenten Heimlichtuerei. Klingt absurd? Macht den Vierteiler auf Magenta TV allerdings sehenswert
Im horizontal erzählten Dramafernsehen hat eigentlich jede Hauptfigur ihre Leichen im Keller - einige verwest, andere noch warm, aber alle mit dem Potenzial, das Haus darüber zum Einsturz zu bringen. Auch ein Vorzeigepolitiker wie Peter Laurence, achtbares Mitglied im Kabinett der konservativen Premierministerin Dawn Ellison und frisch vom Vorwurf der Bestechlichkeit entlastet, dürfe daher seine dunklen Geheimnisse hüten. Warum auch nicht, versichert die englische Regierungschefin ihrem Verkehrsminister. Er müsse sie nur offenlegen. Jetzt.
Weil Laurence auf dem geplanten Weg nach oben den Teufel tut und diese Weigerung zudem mit einer selbstgerecht zynischen Mimik garniert, die kein Darsteller so gut beherrscht wie »Dr. House« Hugh Laurie, dürfte der vierteilige Thriller »Roadkill« also unweigerlich ins politische Pandämonium von »House of Cards« führen; schließlich gleicht sein Souterrain einem Friedhof. Der frühere Immobilienmakler hat nicht nur beruflich viel Dreck am Stecken, dem die ehrgeizige Journalistin Charmian Pepper (Sarah Greene) nachspürt; auch sein Privatleben gleicht einem Leichenschauhaus.
Tochter Susan hat sich von ihm abgewendet. Ihre Schwester Lily tanzt koksend durchs Londoner Nachtleben. Das Bett teilt er mit der Bibliothekarin Madeleine. Aber Ehefrau Helen ist ohnehin nur Fassade diverser Affären, aus denen die verurteilte Finanzbetrügerin Rose hervorgegangen ist. Und dass ihr Vater sie ausgerechnet in jenem Gefängnis kennenlernt, dessen gewaltsamer Aufstand gerade als Anlass seiner Strafvollzugsreform dient, ist Wasser auf die Mühlen unzähliger Feinde - nur, dass es eher die Schwungräder des neuen Justizministers antreibt.
Wer Hugh Lauries sehr, sehr britischen Strippenzieher beim Aufsteigen zusieht, fühlt sich also unweigerlich an Kevin Spaceys sehr, sehr amerikanischen Spin-Doctor Francis Underwood erinnert, der »House of Cards« vor seinem Absturz zur erfolgreichsten Politserie aller Zeiten machte. Und wenn auch noch ein dezidiert linker Dramaturg wie David Hare (»Der Vorleser«) die Drehbücher schreibt, sollte das Format der dezidiert regierungskritischen BBC mächtig auf diese fiktionalen Tories einprügeln. Eigentlich.
Denn unter Michael Keillors geruhsamer Regie erfüllen weder Lawrence noch sonst ein Hegemon im brexit-geplagten, populistisch zerrütteten, völlig unvereinigten Königreich irgendwelche Publikumserwartungen. So verschlagen sich die neoliberale Hauptfigur im Ränkespiel aus Lobbyismus, Korruption und pragmatischem Sex zeigt, wie man es sich auch im deutschen Parlamentarismus vorstellen kann, so reflektiert, offen und modern geht sie dabei mit jener toxischen Männlichkeit um, die das Personal von »House of Cards« so verachtenswert machte. Kein Wunder, dass Laurence in einem Freigehege weiblicher Alphatiere lebt, die den Herren der Schöpfung permanent ihre Vergänglichkeit vor den geöffneten Hosenlatz knallen. Alle vier Gewalten sind vorwiegend mit Frauen von schwindelerregender Autorität durchzogen. Selbst der Knast, in dem Peters heimliche Tochter Rose (Shalom Brune-Franklin) sitzt, ist frei von Y-Chromosomen. Und was hierzulande ähnlich ausgeschlossen ist wie Synchronisationen, die nicht nach Handyreklame klingen: In der angloamerikanischen Fiktion sind doppelt bis dreifach diskriminierte Filmfiguren so normal, dass farbige Anwältinnen weißen Politikern die Machohölle heiß machen, ohne ihre Hautfarbe thematisieren zu müssen.
Das diverse Mit- und Gegeneinander wirkt aber auch deshalb so einladend, weil sich der Cambridge-Absolvent Laurie darin mit dem nonchalanten Snobismus eines Philanthropen bewegt, der das Richtige will, aber nicht unbedingt tut. »Die Leute mögen mich, weil ich die Regeln breche«, sagt sein Peter Laurence. »Das ist mein Reiz, mein Alleinstellungsmerkmal«. Und weil es so transparent und aufrichtig klingt, ist es zugleich der Reiz, das Alleinstellungsmerkmal von »Roadkill«. Fortsetzung sehr erwünscht.
»Roadkill« auf Magenta TV
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.