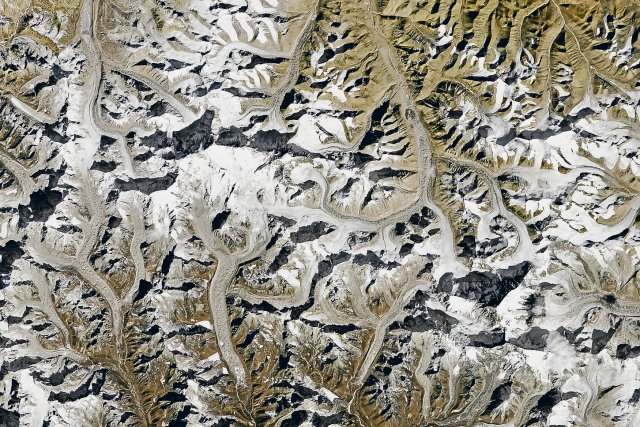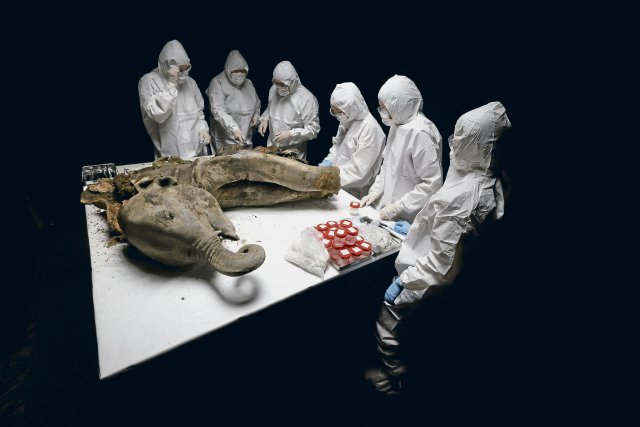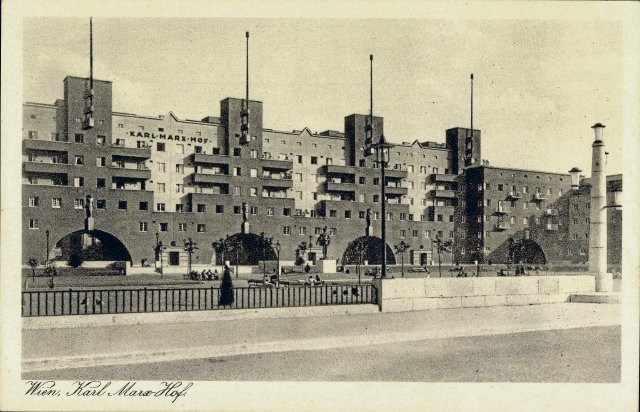Roboter kommt ja von Rabota
DR. SCHMIDT ERKLÄRT DIE WELT: Was können Roboter und wo sind (noch) ihre Grenzen?
Bei Olympia rollt in den Basketballpausen ein Roboter aufs Spielfeld, der den Ball aus jeder Position in den Korb wirft. Sieht gut aus, aber ist es eine Innovation?
Jein. Da ist technisch nicht so furchtbar neu. Er muss nur seine eigene und die Position des Korbes erkennen, die Kraft und die ballistische Kurve berechnen, die der Ball nehmen muss. Lustiger und anspruchsvoller wäre es, wenn er den Ball fangen könnte.Oder aus der Bewegung werfen.
Es gibt schon Roboter mit mehr Bewegungspotenzial. Die Firma Boston Dynamics hat mal eine Art Roboterhund gebaut, der wohl als Gepäckträger für Soldaten im Feld gedacht war. Es gibt einen zweibeinigen, der tanzt und Purzelbäume macht. Die Frage ist, ob diese Roboter selbst dazulernen können.Könnte Toyota solche Spielchen für Erkenntnisse beim autonomen Fahren nutzen?
Das wäre sicherlich eine Option. Aber Toyota baut nicht nur Autos, sondern auch Industrieroboter.Wo stecken heute schon anspruchsvolle Roboter drin?
Zum Beispiel eben in der Autoindustrie, an den Fertigungsstraßen. Oder bei der Betreuung von Dementen, wo Roboter als Kommunikationspartner ausprobiert werden. Oder Roboter, die Menschen mit Bewegungseinschränkungen helfen. Der Roboter, der komplett den Haushalt schmeißt, ist aber leider noch nicht da.Immerhin gibt es automatische Rasenmäher und Staubsauger.
Ja, die nehmen uns Arbeit ab. Der Begriff Roboter kommt ja vom slawischen Rabota, also Arbeit. Karel Čapek hat ihn geprägt. Das Dumme ist nur, dass du möglicherweise der Herstellerfirma den Grundriss deiner Wohnung oder deines Grundstücks in die Datenwolke lieferst.Ist der Basketballroboter schon ein Fall von Künstlicher Intelligenz?
Eher nicht. Da hat das zweibeinige Gerät, eine Art halber Hund, das fünf Kilometer gelaufen ist, schon mehr davon, nämlich Elemente eines selbstlernenden Systems.Also wie bei Schach- und Go-Computern.
Wobei man da nicht genau weiß, wie viel die selber lernen und wie viel ihnen einprogrammiert wird. Aber menschliche Topspieler haben auch Trainer, die ihnen helfen. Und dafür Computerprogramme benutzen.Unkonventionelles Denken - ist das der uneinholbare Vorsprung der Menschen?
Im Moment ja. Aber wie lange gilt das noch? Beispielsweise werden in der Erzählung »Ich, der Roboter« von Isaac Asimov den Robotern drei moralische Grundgesetze einprogrammiert. Und der Roboter nimmt die Ankündigung, dass er stillgelegt wird, als Tötungsakt wahr. Diese Form Künstlicher Intelligenz gibt es noch nicht.Wie heißt es in der Toyota-Werbung? Nichts ist unmöglich.
Das ist zu befürchten, und zwar im Guten wie im Schlechten.Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.