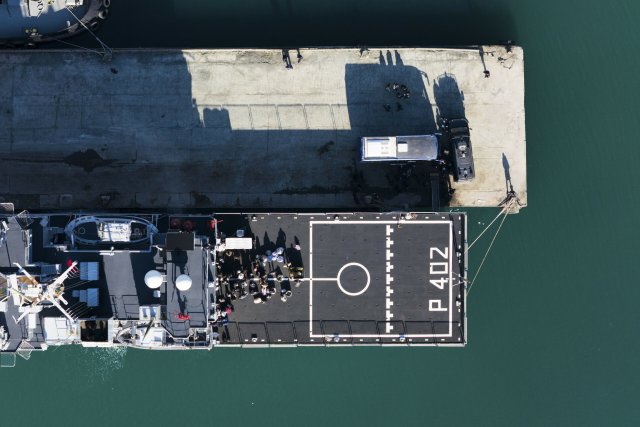- Politik
- Starbucks
Einen Kaffee mit Gewerkschaft bitte
Überall in den USA gründen Mitarbeiter bei Starbucks gerade gewerkschaftliche Vertretungen
Bei Starbucks in Hopewell im US-Bundesstaat New Jersey das Gespräch mit Angestellten zu suchen, hat etwas Konspiratives an sich. Denn Presse, die Fragen stellt, sieht der Konzern, der sonst ein progressives Image vermitteln will, zurzeit nicht gerne. Davon kann die Schichtleiterin Sara Mughal ein Lied singen. Ein Gespräch mit ihr über Twitter zu vereinbaren, war einfach. Aber vor Ort in Hopewell deutet die 31-Jährige mit einer unauffälligen Kopfbewegung und einem über den Tresen geraunten »I can’t talk« hinüber an einen Tisch. Dort sitzen drei Herren, die aufgrund ihres Alters und weil sie die Köpfe zusammenstecken, eine merkwürdige Aura verbreiten. Es handelt sich um, wie Sara später erzählen wird, Starbucks-Funktionäre.
Erst seit Kurzem tauchen sie fast täglich hier auf, nämlich seit die Belegschaft per Brief erklärt hat, sich zu einer Gewerkschaft zusammenfinden zu wollen. Früher sei das anders gewesen, sagt Sara, »vielleicht zeigte sich von denen jemand einmal die Woche und dann sogar freundlich, heute fast jeden Tag. Normal ist das nicht. Sie wollen zeigen, dass sie ein Auge auf uns haben und uns mürbe machen.« Sie arbeitet seit zwei Jahren hier. Nach dem Abbruch ihres College-Studiums hatte sie als Webdesignerin und in weiteren prekären »freien« Jobs gearbeitet. Sara Mughal ist eine der Mitstreiter*innen im gewerkschaftlichen »Starbucks-Organizing«.

Teller und Rand ist der neue ndPodcast zu internationaler Politik. Andreas Krämer und Rob Wessel servieren jeden Monat aktuelle politische Ereignisse aus der ganzen Welt und tischen dabei auf, was sich abseits der medialen Aufmerksamkeit abspielt. Links, kritisch, antikolonialistisch.
Begonnen hatte es für sie »mit Buffalo«. Dort, ganz oben im Norden, direkt an der Grenze zu Kanada, hatte am 9. Dezember die Belegschaft einer Starbucks-Filiale für einen Betriebsrat gestimmt. Eine weitere Filiale folgte. Die Nachricht verbreitete sich schlagartig über soziale Medien unter dem Hashtag #SBWorkersUnited. Sara tweetet seitdem nicht nur eifrig mit, sondern brachte die Gewerkschaftsidee gegenüber ihren Kolleg*innen ins Gespräch. Es dauerte nicht lange, bis auch die Hopewell-Belegschaft in der Mehrzahl zustimmte, dem Starbucks-Management einen entsprechenden Brief zu schreiben.
John Logan, Professor an der San Francisco State University und Leiter des Fachbereichs Labor and Employment Studies, sieht in den Starbucks-Organizing-Bemühungen eine mögliche Initialzündung hin zur Wiederbelebung der am Boden liegenden Gewerkschaftsbewegung.
Wie andere Experten der US-Arbeiterbewegung ist er einerseits skeptisch, denn die Gewerkschaften »können sich aus diesem Loch nicht mit bloßem Organizing befreien: Das Erkämpfen von Betriebsräten in allen US-Starbucksfilialen wäre für sich alleine bedeutungslos, denn sie stellen nur einen Bruchteil der im Privatsektor Beschäftigten dar«, sagt er. Andererseits: Wenn »nur in 100 Filialen Betriebsräte entstehen, könnte das bei anderen Beschäftigten Interesse wecken und Begeisterung auslösen«.
Gekoppelt mit einer Gewerkschaftsführung, die die Zeichen der Zeit versteht – etwa dass die Mehrzahl der in den Dienstleistungssektoren Beschäftigten Frauen und People of Color sind –, wäre sehr viel mehr möglich. Die Gewerkschaftsführung müsste Belegschaften dann aber mehr als nur Anwaltsberatung zur Verfügung stellen, ist sich Logan sicher.
Denn mächtige Unternehmen wie Starbucks leisten sich ganze Heere von PR-Fachleuten und Anwälten, die auf »union busting«, das Bekämpfen von Gewerkschaften, spezialisiert sind. Eine erneuerte Gewerkschaftsbewegung könnte die größten Erfolge seit vielen Jahrzehnten erzielen. Das denken seit dem Aufflammen zahlreicher Streiks im Herbst viele Beobachter*innen.
Starbucks hat rund 230 000 Angestellte in mehr als 9000 Filialen. Im Vergleich zu anderen Branchen im Nahrungsmittel- und Einzelhandelssektor sind Starbucks-Kunden gut ausgebildet und sind eher liberal und links, fallen unter den diffusen Sammelbegriff »progressiv«. Dasselbe gilt laut Logan für die Starbucks-Angestellten mit »vielen jungen Leuten, Bernie-Anhängern und DSA-Aktiven«.
Ähnliches trifft auf Hopewell zu. Zwar ist die Filiale kein besonders sozial anziehender Ort, denn sie befindet sich in einem unansehnlichen Einkaufszentrum. Wer hier einen Kaffee ersteht, lässt sich nicht nieder zum gemütlichen Kaffeetrinken, sondern nimmt den Pappbecher mit ins Auto. Aber die Eliteuniversität Princeton und das College of New Jersey befinden sich unmittelbarer Nachbarschaft. Alter, Kleidung – das Hochschulflair ist der Starbucks-Kundschaft anzusehen.
Die 23-jährige Hailey arbeitet erst seit einem Monat bei Starbucks, hat sich aber sofort der Gewerkschaftsbewegung angeschlossen, nachdem Sara Mughal sie »sachte auf die Seite zog und fragte, ob ich schon die Nachricht von Buffalo gehört hatte«. Hailey räumt ein, der Starbucks-Job sei »finanziell und sozialversicherungstechnisch der beste«, den sie je hatte: »Gut 15 Dollar Einstiegslohn, etliche bezahlte freie Tage, Übernahme der Krankenversicherung einschließlich Zahnarzt und dann auch Gratis-Spotify und Gratis-Headspace.«
Trotzdem ist sie für die Gewerkschaft, wegen »ganz schlechtem Schutz vor Covid und heftigem Arbeitsstress«. Da Kolleg*innen krank wurden, kürzte das Unternehmen beispielsweise die Arbeitspausen zusammen. Wenn Kunden ohne Maske ins Café kommen, dürfen Angestellte nichts sagen.
Schichtleiterin Sara Mughal bestätigt, die Arbeitsbedingungen hätten sich mit Beginn der Pandemie im März 2020 verschlechtert. »Man fühlte sich nicht mehr sicher, und das Unternehmen stellte die Wünsche der Kundschaft über unsere Bedürfnisse.« Sara sagt weiter: »Als Arbeiterin hast du keine gute Wahl: Entweder selbst kündigen und ins Ungewisse blicken – oder sich beschweren, mit dem Risiko, dass man rausgeschmissen wird. Da überlegt man sich dann schon, was man langfristig dagegen machen könnte. Und die Antwort lautet immer: sich gewerkschaftlich zusammentun.«
In über 50 Starbucks-Filialen haben Belegschaften mittlerweile Interesse an der Gewerkschaft bekundet. Nun liegt der Ball beim Konzern. Aller Erfahrung nach stehen demnächst betriebsinterne Versammlungen an, auf denen die Manager vor Gewerkschaften warnen. In Buffalo wurden »Aufrührer« davon ausgeschlossen, es gab Kündigungsdrohungen. »Sie werden den Druck massiv verstärken«, befürchtet Sara Mughal, »aber wir halten mit allen Mitteln dagegen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.