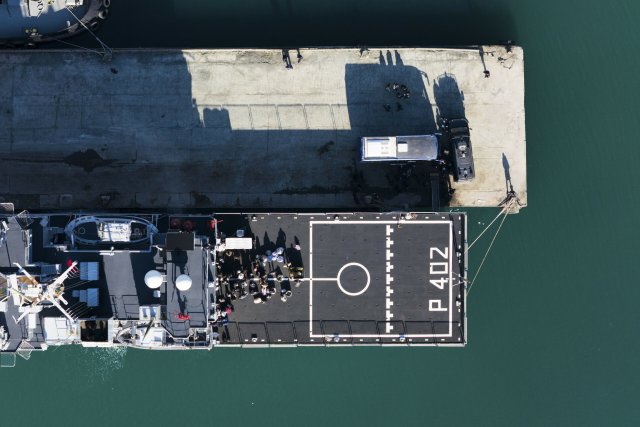- Politik
- Ehemalige Zwangsarbeitsanstalt in Leipzig
Disziplinierung hinter Backsteinmauern
In der einstigen Leipziger Zwangsarbeitsanstalt gibt es jetzt eine Gedenkstätte – die kurz nach der Eröffnung ohne Förderung dasteht

Die Bezeichnung »Heim für soziale Betreuung« klingt für Wohlmeinende nach Obhut und Fürsorge. Beate F. fand sie in einer Auflistung der Lebensstationen ihrer Mutter. Die dunkelhaarige Frau, die heutige Mitte Fünfzig ist, war bei ihrem Vater aufgewachsen und hatte als junge Frau zu recherchieren begonnen, wer ihre Mutter war. In einem amtlichen Schreiben stieß sie auf die Bezeichnung »Heim für soziale Betreuung«, ergänzt um eine Adresse: Riebeckstraße 63 in Leipzig. F. dachte nicht an Obhut und Fürsorge, sondern war sich sicher, dass ihre Mutter in den 27 Monaten, die sie dort verbrachte, keine gute Zeit hatte: »Das Wort ›Betreuung‹ hatte in der DDR sehr oft einen schalen Beigeschmack.«
In der Gedenkstätte, die vor einigen Wochen in der Riebeckstraße 63 eröffnet wurde, bekommen Besucher diese Vermutung bestätigt. In einem kleinen Raum finden sich an den Wänden historische Fotografien und Schrifttafeln, in denen knapp über die Nutzung des Gebäudes in Kaiserreich und Weimarer Republik, in der NS-Zeit und den DDR-Jahren informiert wird. Darunter sind flache Regale angebracht, in denen Pappschatullen stecken. Jede informiert über ein Schicksal, das mit der Riebeckstraße 63 verbunden ist. Im Fall von Gerlinde D., die 1941 geborenen wurde und auf einem beiliegenden Passbild mit ihren dunklen Haaren und Augen ihrer Tochter ausgesprochen ähnlich sieht, wird erklärt, sie sei am 26. März 1965 in das Heim gekommen, im Alter von 23 Jahren und nur elf Tage nach der Entbindung ihres zweiten Sohns. Früher hatte sie bereits drei Jahre in einem Jugendwerkhof verbringen müssen. Als Grund für die Einweisung in die Riebeckstraße wurde angegeben: »Rumstreunerei und asoziales Verhalten«.
Dramen hinterließen Spuren
Beate F. kann nicht sagen, was ihrer Mutter genau zur Last gelegt wurde. Sie hatte diese irgendwann ausfindig gemacht, Kontakt aufgenommen und sie am Telefon auch nach ihrem Leben befragen wollen. »Sie wollte nicht darüber reden«, sagt die Tochter, die ausweichende und brüsk ablehnende Antworten erhielt. Sie weiß aber, dass der Aufenthalt im »Heim für soziale Betreuung« ihrer Mutter nicht auf einen »geraden« Lebensweg verholfen hat. Stattdessen folgten auf die Jahre in der Riebeckstraße eine aufgrund von fehlenden Abschlüssen unstete berufliche Karriere und Ehen, die in die Brüche gingen. Bevor sie 2014 starb, mit bereits einsetzender Demenz, habe ihre Mutter jedenfalls ein eher bitteres Resümee ihres Lebens gezogen, sagt die Tochter.
Dass über dieses jetzt in einer Gedenkstätte informiert wird, ist einem Initiativkreis zu danken, der sich seit 2019 bemühte, die Geschichte des Ortes aufzuarbeiten. Dieser sei »bundesweit einzigartig«, sagt Francesca Weil. Sie ist Historikerin, arbeitet am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung (HAIT) an der TU Dresden und findet es als Wissenschaftlerin bemerkenswert, dass in der Riebeckstraße 63 »alle Dramen des 20. Jahrhunderts« ihre Spuren hinterlassen hätten. Über ganz verschiedene politische Systeme hinweg sei es »stets darum gegangen, Menschen zu disziplinieren, die von der gesellschaftlichen Norm und vom Durchschnitt abwichen«.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Ursprünglich errichtet wurden die heutigen Gebäude im Jahr 1892. In der Riebeckstraße 63 entstand damals die städtische »Zwangsarbeitsanstalt St. Georg«. Neben einem dreistöckigen Hauptgebäude mit einem von Stuck gekrönten Portal gab es mehrere flachere Gebäude, alle errichtet aus gelblichem Backstein. Das 28 000 Quadratmeter große Areal war von einer Mauer umschlossen. Darüber, wer das Gelände durch die hohen Tore betreten und verlassen konnte, wurde aus einem Pförtnerhaus gewacht, das heute die Gedenkstätte beherbergt.
In die Anstalt wurden von städtischen Behörden zunächst Menschen eingewiesen, die »infolge von Arbeitsscheu, Trunksucht oder lüderlichem Lebenswandel« Wohnung und Arbeit verloren hatten. So steht es in Regularien für die Einrichtung, als deren Zweck neben Unterbringung und angemessener Beschäftigung auch die »sittliche Besserung« genannt wurde. Armut, Obdach- und Arbeitslosigkeit waren bereits im 19. Jahrhundert zu Begleiterscheinungen der Industrialisierung geworden, spätestens in der Weimarer Republik stellten sie ein Massenphänomen dar. Dass die Anstalt zu irgendeiner Besserung beitragen könnte, wurde in zeitgenössischen Presseberichten stark bezweifelt. Die damals sozialdemokratische »Leipziger Volkszeitung« schilderte 1929 verheerende hygienische Zustände in der überfüllten Einrichtung und sprach von einer »Pesthöhle«, die einer Stadt wie Leipzig unwürdig sei. An anderer Stelle hieß es, in der Riebeckstraße sei es »schlimmer als in der Strafanstalt«.
In der NS-Diktatur verschärfte sich die Repression erheblich. Die Riebeckstraße sei ein »zentraler Ort der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik in Leipzig« geworden, heißt es in der Ausstellung. Sinti und Roma mussten Pflichtarbeit leisten, um Fürsorgeleistungen zu erhalten. Das Areal diente als Durchgangslager für Juden auf dem Weg in die Vernichtungslager und war, wie die Historikerin Weil formuliert, auch ein »Umschlagplatz« für Zwangsarbeiter aus ganz Europa, die in der Leipziger Industrie eingesetzt wurden.
Daneben wurden weiterhin angeblich »arbeitscheue und asoziale« Menschen in der Riebeckstraße 63 schikaniert. Eine von ihnen war die 1910 geborene Elsa Knabe, die 1937 nach einer Schwangerschaft vom städtischen Fürsorgeamt entmündigt und in die Anstalt eingewiesen wurde, weil ihr häufig wechselnde Partnerschaften zur Last gelegt wurden. In einem Schreiben an das Amt hieß es zwei Jahre später, die »Arbeitsleistung« der jungen Frau lasse noch immer zu wünschen übrig, sie arbeite langsam und liederlich und neige zu Frechheit. »Um ihr den Ernst des Lebens beizubringen«, so das Fazit der Anstaltsmitarbeiter, »bedarf sie längerer Verwahrung«. Ein Jahr später wurde ein Fragebogen mit ihren Daten in die Berliner Tiergartenstraße 4 geschickt, wo die später als »Aktion T4« bekannt gewordene systematische Ermordung von psychisch und körperlich behinderten Menschen koordiniert wurde. Elsa Knabe wurde zunächst in eine »Pflegeanstalt« im sächsischen Zschadraß verbracht und dann in die Anstalt Pirna-Sonnenstein, wo sie am 22. Februar 1941 in der Gaskammer ermordet wurde.
Auch in der DDR blieb die Riebeckstraße 63 ein »Ort der Repression«, wie Francesca Weil betont. Ab 1946 gab es dort ein »Fürsorgeheim für Geschlechtskranke«, das 1952 in eine geschlossene Venerologische Station umgewandelt wurde, im Volksmund »Tripperburg« genannt. Mädchen und Frauen seien dort oftmals ohne gesetzliche Grundlage zwangsweise eingewiesen und gegen ihren Willen täglich auf Geschlechtskrankheiten untersucht worden. Es habe sich nicht um einen »Ort der Genesung, sondern der Disziplinierung« gehandelt, heißt es beim Initiativkreis. Die Historikerin Weil weist darauf hin, dass es ähnliche Heime auch in der frühen Bundesrepublik gegeben habe, »sowohl in staatlicher als auch in kirchlicher Trägerschaft«, zudem in Ländern wir Irland oder Schweiz. In der DDR seien Einrichtungen wie in der Riebeckstraße aber stark ideologisiert worden: »Da ging es immer darum, sozialistische Persönlichkeiten zu formen.« Das galt auch für das »Heim für soziale Betreuung«, das neben der Venerologischen Station hinter den gelben Backsteinmauern bestand, mit dem die Tradition der Arbeitsanstalt fortgesetzt wurde und in das unter anderem Beate F.s Mutter eingewiesen wurde.
»Über verschiedene politische Systeme hinweg wurden hier Menschen diszipliniert, die von der Norm abwichen.«
Francesca Weil Historikerin
Ein nach außen abgeschlossener Ort blieb die Riebeckstraße 63 auch nach dem Ende der DDR. In deren letzten Jahren war dort eine Außenstelle des Bezirkskrankenhauses für Psychiatrie und Neurologie Leipzig-Dösen eingerichtet wurden; 1990 lebten dort 185 Patienten. »Das Tor war ständig zu, man konnte nicht sehen, was hinter den Mauern passiert«, sagt Rosi Haase. Die Grafikerin gehörte Anfang der 1990er Jahre zu einer Gruppe, die auf eine »Enthospitalisierung« der psychisch Kranken drängte. Sie habe ein Menschenbild vertreten, dass diesen eine freiere Entfaltung und ein selbstbestimmteres Leben ermöglichen wollte, sagt die Künstlerin, deren Einsatz für psychisch Kranke im Jahr 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde und die einmal von sich sagte: »Unter Verrückten fühle ich mich am wohlsten.« Für die Riebeckstraße träumte sie davon, die Anstalt in ein Kulturzentrum umzuwandeln. Die Widerstände waren indes groß. Als sie mit ihren Mitstreitern beispielsweise ein Sommerfest gemeinsam mit Insassen, Personal und Nachbarn organisieren wollte, sei das bei den Beschäftigten auf Ablehnung gestoßen: »Sie meinten, sie könnten die Tore nicht öffnen, weil sie die Insassen beschützen müssten.«
Die Tore öffneten sich dann doch, die Nutzung des Areals wandelte sich. Seit 1999 wird es vom Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe (SEB) genutzt, der dort unter anderem eine Kindertagesstätte, eine Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe sowie Unterkunft für Geflüchtete betreibt. Allerdings erinnerte nichts mehr an die rund 100-jährige Vorgeschichte als Ort der Disziplinierung. Der Initiativkreis entstand 2019 mit dem Ziel, das zu ändern.
Ausstellung eröffnet
Fünf Jahre später ist dieses erreicht. Im früheren Pförtnerhaus der Arbeitsanstalt eröffnete im Februar unter dem Titel »Ausgrenzung, Arbeitszwang und Abweichung« eine »Werkstattausstellung«, die, wie betont wurde, »erstmalig die über 100-jährige Gewaltgeschichte der verschiedenen Institutionen« in der Riebeckstraße 63 präsentiert und Biografien unterschiedlicher Betroffener vorstellt. Etabliert werden solle eine »dauerhafte sowie lebendige Erinnerungs- und Begegnungsstätte«.
Allerdings wurde die Freude umgehend getrübt. Die Ausstellung zu erstellen gelang nur dank einer Förderung durch die Stiftung Sächsische Gedenkstätten, die es im vergangenen Jahr erlaubte, zwei Mitarbeiter zu beschäftigen. Im laufenden Jahr steht die neue Gedenkstätte ohne Geld da. Hintergrund ist, dass der Freistaat Sachsen wegen der Landtagswahl im September 2024 und der folgenden Regierungsbildung keinen beschlossenen Haushalt hat. Einstweilen gilt eine »vorläufige Haushaltsführung«. Für die Riebeckstraße 63 gibt es kein Geld. Damit sei eine »positive Dynamik ... vorerst gestoppt«, hieß es in einer Erklärung des Initiativkreises. Führungen und pädagogische Angebote können derzeit nur sehr begrenzt ehrenamtlich angeboten werden. »Es ist frustrierend«, sagt Francesca Weil: »Wir haben so viel geschafft und geschaffen, und jetzt werden wir ausgebremst.«
Die Hoffnung und ihr Engagement wollen sie und ihre Mitstreiterinnen dennoch nicht aufgeben. Weil hat kürzlich der BBC Auskünfte über die Riebeckstraße 63 gegeben: »Da kann man bald weltweit etwas über diesen Ort hören.« Rosi Haas träumt davon, ungenutzte Gebäude auf dem Areal in Ateliers umzuwandeln, in denen auch psychisch Kranke und Geflüchtete künstlerisch tätig werden können. Und Beate F., die erst 2024 zum Initiativkreis stieß, wird weiter zur Geschichte des Orts und dem damit verbundenen Schicksal ihrer Mutter recherchieren: »Was ihr hier widerfahren ist, war schließlich nicht nur für sie, sondern auch für mich und weitere Nachkommen äußerst belastend.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.