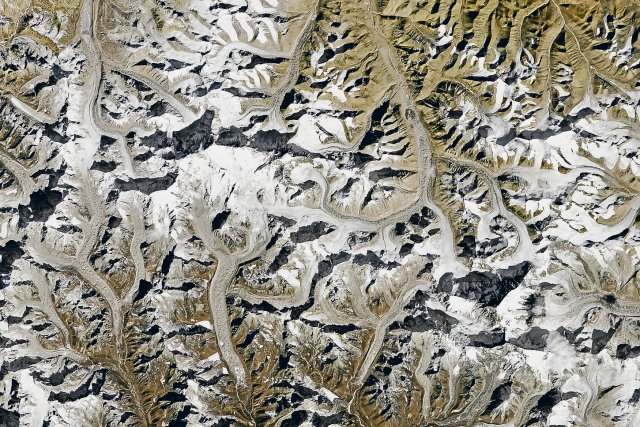- Wissen
- Crispr-Cas9
Designerbabys: Bröckelndes Tabu
Die Genschere Crispr-Cas9 hat die biomedizinische Forschung beschleunigt und Möglichkeiten zur Schaffung von Designerbabys eröffnet
Vom 6. bis 8. März werden Expert*innen in London über biotechnologische Eingriffe ins menschliche Genom diskutieren, basierend auf den Möglichkeiten, die die Genschere Crispr-Cas9 eröffnet hat. Kritiker*innen befürchten, dass auch bei der genetischen Veränderung von Embryonen – der Erschaffung von sogenannten Designerbabys – immer mehr ethische Hürden fallen.
Vor zehn Jahren veröffentlichten die Biochemikerinnen Jennifer Doudna und Emanuelle Charpentier eine bahnbrechende Entdeckung ihrer Forschungsteams: Crispr-Cas9, eine neue Technologie zur genetischen Veränderung von Zellen. Für diese Entdeckung wurde beiden 2020 der Nobelpreis für Chemie verliehen. Seit der ersten Nachricht über die neue Technologie des »Genome Editing« wecken Wissenschaft und Medien große Hoffnungen. Eine Revolution der Biotechnologie solle möglich sein, die Heilung aller möglichen Erkrankungen kurz bevorstehen, ebenso wie die Entwicklung von Pflanzen, die den Welthunger trotz Klimawandel endlich stillen würden. Auf der anderen Seite beflügelte die Technologie dystopische Szenarien von genetisch optimierten Designerbabys und Bioterrorismus. Ein Jahrzehnt später hat Crispr-Cas9 in Kombination mit den bioinformatischen Fortschritten tatsächlich eine neue Ära der Biotechnologie eröffnet. Forscher*innen weltweit benutzen Crispr-Cas9, um biomedizinische und genetische Grundlagenforschung deutlich zu beschleunigen. So können mit Crispr-Cas9 wesentlich schneller als mit älteren Methoden Versuchstiere erschaffen werden, bei denen ein bestimmtes Gen deaktiviert ist. Solche »Knock-outs« erlauben einerseits die Untersuchung der Funktionsweise einzelner Gene. Andererseits können sie dazu dienen, Therapien für Menschen mit vergleichbaren Symptomen zu entwickeln.
Die Erfüllung der Übertragung der Ergebnisse in die Klinik ist jedoch schwieriger, als es die Zeitungsüberschriften und enthusiastischen Prognosen von Wissenschaftler*innen vor zehn Jahren versprachen. Die Heilung aller möglichen Erkrankungen ist bisher ausgeblieben. Einerseits sind zehn Jahre in den meisten Forschungsfeldern zu kurz, um fertige Anwendungen zu entwickeln. Andererseits beruhen die wenigsten Erkrankungen tatsächlich auf einzelnen Genvarianten, die einfach »umgeschrieben« werden könnten. Bei den allermeisten Krankheiten wirken polygene Netzwerke hunderter bis tausender Gene schwer trennbar zusammen mit externen Krankheitsauslösern und Umweltfaktoren. Mittels Crispr-Cas9 ist es zwar möglich, mehrere Genvarianten auf einmal zu verändern. Doch davon, die komplexen polygenen Interaktionsnetzwerke zu verstehen, geschweige denn in diese eingreifen zu können, ist die Forschung weit entfernt. Zudem bleibt ein großer Knackpunkt, wie der Genome-Editing-Komplex an die richtige Stelle im Körper von Erkrankten eingebracht werden könnte. Es ist kein Zufall, dass die Entwicklung von Crispr-Cas9-basierten Therapien besonders auf angeborene Bluterkrankungen fokussiert wird. Bei der Sichelzellanämie beispielsweise führt eine einzelne Abweichung im Gen für den Blutfarbstoff Hämoglobin zu einer Verformung und zum Funktionsverlust roter Blutkörperchen. Mindestens acht klinische Studien testen derzeit Crispr-basierte Therapien für diese Erkrankung in den USA, für eine davon wird 2023 die Genehmigung durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA erwartet. Zudem ist die hierfür nötige Stammzellentnahme aus dem blutbildenden System im Knochenmarkrelativ unkompliziert. Bei anderen Organen oder Gewebetypen ist dies nicht so leicht möglich. In einem Überblicksartikel anlässlich des Crispr-Jubiläums im Fachjournal »Science« schreiben die Entdeckerin Jennifer Doudna und ihre Kollegin Joy Y. Wan daher, dass die Zukunft der Crispr-Behandlungen beim Menschen »größtenteils von der Verbesserung der derzeitigen Möglichkeiten der Verabreichungsmodalitäten« abhängen werde.
Doudna und Wan reflektieren in ihrem Artikel vor allem den bisherigen Fortschritt und die Zukunftsaussichten bei somatischen Anwendungen beim Menschen, also Anwendungen, die nur den Körper der jeweiligen Person betreffen und nicht vererbbar sind. Grundsätzlich ethisch wenig umstritten, wird bei solchen Gentherapien lediglich diskutiert, wie Sicherheitsrisiken für Patient*innen begrenzt werden. Sie prognostizieren sowohl, dass in einer »weiter entfernten Zukunft« für viele Erkrankungen Crispr-Therapien verfügbar sein werden, als auch die Existenz von prophylaktischen Behandlungen gegen neurodegenerative oder Herzkreislauferkrankungen. Doch zu der Zukunft einer anderen, wesentlich kontroverseren Anwendung von Crispr-Cas9 äußern sie sich nicht: dem Szenario der Designerbabys. 2015 hatte sich Doudna noch für ein Moratorium für vererbbare genetische Veränderungen am Menschen ausgesprochen. Damals hatte ein chinesisches Forschungsteam erstmals Ergebnisse von Experimenten vorgestellt, bei denen mit künstlicher Befruchtung hergestellte Embryonen durch Crispr-Cas9 genetisch behandelt worden waren. Die grundsätzliche Machbarkeit, die menschliche Keimbahn zu verändern, war bewiesen, auch wenn die Experimente die Fehleranfälligkeit der Methode offenlegten. Wenige Jahre später änderte nicht nur Doudna ihre Meinung zum Thema. Die gesamte internationale wissenschaftliche und ethische Debatte hat sich inzwischen von einem »Ob« zu einem »Wie« verschoben.
Im November 2018, kurz vor dem letzten internationalen Gipfeltreffen zum Thema Genome Editing am Menschen konfrontierte der chinesische Wissenschaftler He Jiankui die Welt mit der Nachricht, er habe die ersten genetisch veränderten Kinder »erschaffen«. Die wissenschaftliche Community reagierte – ebenso wie die Öffentlichkeit – schockiert, als He seine Forschungsergebnisse auf dem Kongress vorstellte. In Reaktion auf die Nachricht wurde versucht, ihn als »rogue scientist«, als isolierten Einzeltäter darzustellen. Später stellte sich jedoch heraus, dass er führende Wissenschaftler*innen über seine Pläne informiert hatte, aber keine*r Alarm geschlagen hatte. Überraschen sollte Hes Vorstoß auch nicht, da zuvor wichtige Ethik- und Wissenschaftsorgane wie der britische Ethikrat und die US-amerikanischen Nationalen Wissenschaftsakademien sich grundsätzlich für vererbbares Genome Editing zur Verhinderung von schweren Erkrankungen oder Behinderungen ausgesprochen hatten. Der britische Ethikrat nannte gar die Erschaffung von »Supersinnen« und »Superfähigkeiten« als mögliche Ziele, die der »reproduktiven Freiheit« Einzelner überlassen werden sollten. Auch der deutsche Ethikrat hat inzwischen geurteilt, dass vererbbares Genome Editing grundsätzlich moralisch zulässig sei. Alle diese Statements formulieren vage Kosten-Nutzen-Abschätzungen als Grundlage für den Beginn klinischer Studien, die eine Reduzierung der Fehleranfälligkeit der Technologie voraussetzen, aber die Höhe des hinnehmbaren Risikos nicht konkret benennen. He hatte offensichtlich diese Abwägung anders getroffen als der wissenschaftliche Mainstream und war von den negativen Reaktionen überrascht.
Der Kongress 2018 endete mit einem Statement der Organisator*innen, in dem sie zwar Hes Experimente verurteilten, aber gleichzeitig basierend auf dem aktuellen Stand der Forschung proklamierten, es sei »an der Zeit, einen rigorosen, verantwortungsvollen Weg zur Durchführung klinischer Studien zu definieren«. Dementsprechend wird für den dritten, wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Gipfel vom 6. bis 8. März in London erwartet, dass die Planung der ersten vermeintlich »wissenschaftlich verantwortungsvollen« klinischen Studien konkretere Formen annimmt. Die »International Coalition to Stop Designer Babies«, ein Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen wie dem US-amerikanischen Center for Genetics and Society und dem deutschen Gen-ethischen Netzwerk kritisiert, dass Wissenschaftler*innen weitestgehend ohne Beteiligung der Zivilgesellschaft über die Zukunft der Menschheit entscheiden wollten. Sie sieht in vererbbarem Genome Editing einen Verstoß gegen die Menschenwürde, weil sie den Menschen auf den »Status eines designten und optimierten Konsumobjekts reduziert«.
Tatsächlich ist vererbbares Genome Editing in den meisten Ländern aus diesen Gründen momentan verboten. Hierzulande gilt beispielsweise – abgesehen vom deutschen Embryonenschutzgesetz – die Oviedo-Konvention der EU. Sie verbietet Interventionen, die auf »eine Veränderung des Genoms von Nachkommen« abzielen. Vorangetrieben durch die Versprechen der Wissenschaft könnten diese gesetzlichen Einschränkungen jedoch bald bröckeln: In Großbritannien wird momentan darüber diskutiert, Keimbahnveränderungen noch in diesem Jahr zu legalisieren. Selbst nach aller technischer Optimierung würden klinische Studien immense Risiken für nicht einwilligungsfähige Kinder bedeuten, die so auf Wunsch ihrer Eltern und ehrgeiziger Wissenschaftler*innen »erschaffen« würden. Crispr-Cas9 und seine präziseren Derivate sind nicht fehlerlos, und Schäden durch die Behandlung würden an alle nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. Ein großes Risiko dafür, dass kein einziger existenter Mensch therapiert werden würde: Die »geheilten« Embryonen würden schließlich erst für die Behandlung erschaffen werden.
Selbst bei einer völlig risikolosen Anwendung von Crispr-Cas9 an Embryonen in der Zukunft befürchten Kritiker*innen negative Auswirkungen für die Gesellschaft. Die US-amerikanische Organisation »Alliance for Humane Biotechnology« spricht von einer neuen Ära der »Techno-Eugenik« in der Crispr-Cas9 eugenische Fantasien der Eliminierung aller möglichen Erkrankungen und Behinderungen denkbar macht und die existente gesellschaftliche Behindertenfeindlichkeit verstärkt. In einem Kommentar zum Thema Genome Editing benannte die US-amerikanische Behindertenvertreterin Rebecca Cokley ihre Kleinwüchsigkeit als Teil ihrer Identität; Kleinwüchsige besäßen »eine reichhaltige Kultur, so wie viele Behindertengruppen«. »Wo ist die Grenze zwischen dem, was die Gesellschaft als furchtbare, genetische Mutation wahrnimmt, und der Kultur von jemandem?«, fragte Cokley ihre Leser*innen. Die Hoffnung, dass die internationale wissenschaftliche Community selbstregulierend agiert und sich an bestehende ethische und gesetzliche Maßstäbe hält, scheint sich nicht zu erfüllen. Es ist Zeit, dass Politik und Zivilgesellschaft die Existenz von Designerbabys als Realität begreift und sich kritisch mit den Konsequenzen auseinandersetzt, wenn Technologieinnovation als einziger Maßstab für gesellschaftliche Entwicklungen angesetzt wird.
Dr. Isabelle Bartram ist Molekularbiologin und Mitarbeiterin beim Gen-ethischen Netzwerk e. V.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.