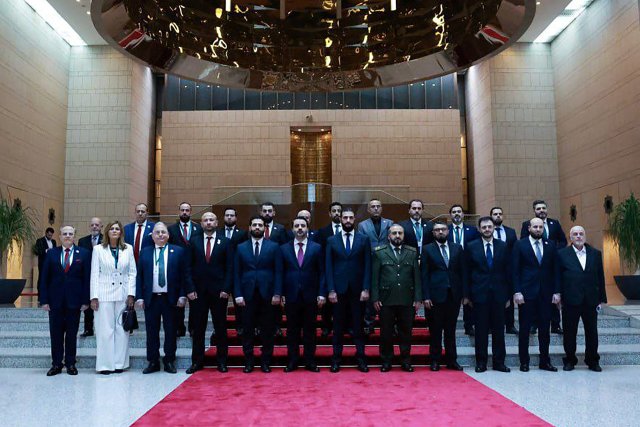- Politik
- Jahresbericht
Kolumbien: Menschenrechtsaktivisten leben gefährlich
Neuer Jahresbericht vermerkt in Kolumbien mit weitem Abstand die meisten Morde

Es sind keine guten Nachrichten, die die irische Nichtregierungsorganisation Front Line Defenders (FLD) in ihrem Jahresbericht anzubieten hat: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 401 Menschenrechtsaktivist*innen rund um den Globus getötet. Damit überschritt die Zahl der Toten erstmals die 400er-Marke. Ein Großteil der Opfer stammt aus Lateinamerika und davon mit weitem Abstand die allermeisten aus Kolumbien: 186 Menschenrechtsverteidiger*innen bezahlten 2022 dort ihren Einsatz mit dem Leben.
Es gibt auch gute Nachrichten aus Kolumbien. Der linke Präsident Gustavo Petro verhandelt mit mehreren illegal bewaffneten Akteuren, um den Massakern, Zwangsvertreibungen und unzähligen Morden ein Ende zu setzen. Die Regierung möchte einen dauerhaften Waffenstillstand mit allen noch aktiven bewaffneten Vereinigungen herbeiführen. Petros proklamiertes Ziel heißt »vollkommenen Frieden«. Leider spiegelt sich dieser Traum bisher nicht in den nationalen Mordraten wider. 46 Prozent der weltweiten Morde an Aktivisten entfallen laut FLD auf Kolumbien und das, obwohl der Regierungschef Petro dem Schutz der Aktivist*innen Priorität verleihen wollte. Die aktuellen Zahlen wurden nur im Pandemiejahr 2020 mit 223 Tötungen überschritten.
Ländliche und indigene Regionen besonders betroffen
Von der Gewalt in Kolumbien besonders betroffen sind ländliche Gegenden, in denen der Staat häufig abwesend ist und bewaffnete Gruppen wie die ELN-Guerilla, der narco-paramilitärische Golf-Clan oder rechte Paramilitärs das Sagen haben. Diese wollen sich die Einnahmen aus dem Rohstoffabbau und die Vorherrschaft über strategisch wichtige Routen für den Drogenschmuggel nicht entgehen lassen. Laut der Stiftung Pares gibt es »systematische tödliche Angriffe auf indigene Führungspersonen«, die versuchen, ihre Territorien vor den Zugriffen dieser Akteure zu schützen.
Neben den Verteidiger*innen der Menschenrechte, leben Umweltaktivist*innen vor Ort besonders gefährlich: Das ressourcenreiche Land zieht multinationale Unternehmen und Agraroligarchen, insbesondere aus Europa und den USA in großem Stil an. Sie nehmen in ihrem Profitstreben wenig Rücksicht auf die Folgen ihres Tuns für die dort lebende Bevölkerung. Besonders betroffen sind indigene und afro-kolumbianische Gemeinschaften, denen oft nichts anderes übrigbleibt, als der Zerstörung ihrer Lebensgrundlage zuzusehen. Im Norden des Landes leben die Einheimischen Wayuú. Auf deren Territorium befindet sich eine der größten Kohleminen der Welt, aus der auch Deutschland Importe bezieht. Seit Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine lockt das Kohlegeschäft noch mehr Raubritter an – die Nachfrage steigt.
Fatale Folgen im Nordosten Kolumbiens
Seit Jahren protestieren die vom Raubbau Betroffenen und ihre Unterstützer*innen vergeblich gegen das ausbeuterische System und die Verschmutzung ihres Wassers, denn es bedeutet »Elend für die Wayuú, Reichtum für die Europäer«. Mehr als 60 Prozent der dortigen Bevölkerung lebt in Armut. Politisches Engagement gegen die Bedrohungen endet vielmals in Todesdrohungen oder Morden. Die Armut in La Guajira ist die Hauptursache für die Kindersterblichkeit. 5320 Kinder starben zwischen 2008 und 2021 an Unterernährung und anderen damit zusammenhängenden Ursachen, davon waren 20 Prozent unter fünf Jahre alt und 74 Prozent gehörten indigenen Ethnien an.
Die, die sich gegen die Abholzung des Waldes wehren, der gigantischen Viehzuchtfarmen weichen muss, werden nicht selten getötet. Kongressabgeordnete haben mehrfach versucht, einen Gesetzesentwurf einzubringen, der die extensive Rinderwirtschaft einschränken soll, bisher ohne Erfolg. Die bereits bestehenden Naturschutzregeln werden vielerorts ignoriert und das Mitspracherecht der betroffenen Bevölkerung ignoriert. Immerhin wirkten ethnische Minderheiten bei der Ausarbeitung des »nationalen Entwicklungsplans«, der das Regierungshandeln bis 2026 leiten soll, mit. Dem Umweltschutz wurde erstmals eine Schlüsselrolle in der nationalen politischen Agenda eingeräumt.
Aktivismus ist in Lateinamerika gefährlich
Der Leiter der nationalen Ombudsbehörde Carlos Camargo erklärt, warum die Aktivisten zur tödlichen Zielscheibe werden: »Das sind Führungspersönlichkeiten, die die Anliegen der Menschen aufgreifen, die ihre Sprecher sind und die sich für ein Land einsetzen, in dem die Menschenrechte geachtet werden.«
Nach Kolumbien steht Mexiko mit 45 ermordeten Menschenrechtsaktivist*innen an zweiter Stelle, gefolgt von Brasilien (26) und Honduras (17).
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.