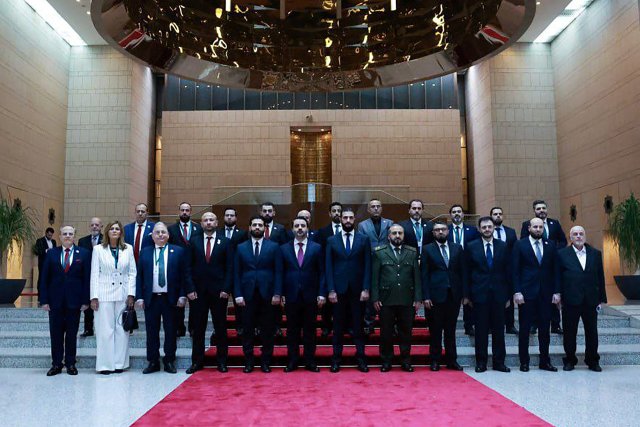- Politik
- Mexiko
Die fünf Freunde und die Fabrik der Verbrechen
Über die Maschinerie aus Korruption und Bürokratie zur Kriminalisierung von Protest gegen Infrastrukturprojekte im Süden Mexikos

Es ist Sonntagmittag. Der Gottesdienst ist gerade zu Ende und Manuel Sántiz sitzt zusammen mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern unter dem Vordach der Kirche. Zwischen den umliegenden Gebäuden befindet sich eine kleine Wiesenlandschaft mit Wegen, im Schatten der Bäume und unter Sonnensegeln aus Decken sitzen zahlreiche Familien. Sie frühstücken gemeinsam, spielen Karten oder schauen ernst schweigend dem Treiben zu. Viele Männer sind auf den schmalen Wegen zwischen den Gebäuden unterwegs, die meisten indigener Herkunft, einfache Leute, mit von körperlicher Arbeit geprägten Schultern. Ein paar wenige sind bis ins Gesicht hinein tätowiert. Zahlreiche Männer betreiben Handarbeit, sie knüpfen und weben. An den Zäunen hängen ihre bunten Hängematten, gehäkelte Taschen und Tierfiguren zum Verkauf. Die Sonne knallt erbarmungslos an diesem Sonntag auf das friedlich erscheinende Treiben der Männersektion des CERSS 5, der Gefangenenanstalt von San Cristóbal de Las Casas im Süden Mexikos. Es ist offener Besuchstag.
Sántiz, der hier seit Mai 2022 zusammen mit vier Freunden aus der Kleinstadt San Juan Cancuc einsitzt, ist nur einer von vielen, unschuldigen und politischen Gefangenen des zutiefst korrupten Justizsystems von Mexiko. Den fünf wird der Mord an einem Polizisten vorgeworfen, sie wurden für 25 Jahre verurteilt. Aufgrund der gravierenden Widersprüche durchlief der Fall gerade die Revision. Er ist exemplarisch für die Repression gegen politische Aktivist*innen, Korruption und Rassismus im mexikanischen Justizapparat, aber auch für die große Bedeutung nationaler wie internationaler Solidarität.
Fabrikation von Verbrechen
Alles fing an mit einer nächtlichen Ruhestörung der anderen Art. Sántiz und seine Freunde hörten spät abends verzweifelte Schreie in ihrem Stadtteil. Gemeinsam näherten sie sich. Ein örtlicher Polizist war, schwer betrunken, gestürzt und hatte sich verletzt. Die fünf zogen ihn gemeinsam mit anderen Nachbarn aus dem Gestrüpp und übergaben ihn seinen Kollegen. Was dann passierte, ist unklar, sicher ist, dass der Mann später von seiner Ehefrau als tot gemeldet wurde. Davon wussten Sántiz sowie Agustín Pérez und Juan V. Aguilar jedoch nichts, als sie noch in derselben Nacht festgenommen wurden. Der Verkauf von Drogen im nahegelegenen San Cristóbal wurde ihnen vorgeworfen. Doch das musste ein Missverständnis sein, erklärt Pérez. »Vertrauensvoll gingen wir mit, weil wir wussten, dass wir nichts getan hatten.«
In Mexiko gibt es ein sich wiederholendes Muster, wie von den Staatsanwaltschaften Verbrechen fingiert werden, um Menschen hinter Gitter zu bringen. Das Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dokumentiert und begleitet diesen und ähnliche Fälle seit Jahren. Dora Roblero, die Direktorin des Zentrums, erklärt, dass es sich um ein institutionalisiertes System der Fabrikation von Verbrechen und Schuldigen handele. In den meisten Fällen würden Unschuldige wegen vermeintlichen Drogenbesitzes in flagranti festgenommen. Die Zeit der Präventivhaft würde genutzt, um »eine komplette Ermittlungsakte mit fabrizierten Verbrechen und oftmals erfolterten Beweisen« zu erstellen. Daraufhin werden die Betroffenen dann erneut festgenommen, diesmal für einen wesentlich schwereren Delikt.
Dies ist auch bei den Genossen aus Cancuc der Fall. Zwei Tage nach der Festnahme sollen die drei entlassen werden, nur um direkt erneut verhaftet zu werden. Unwissend dessen was in der Gefängnisverwaltung gerade passiert, warteten an jenem Tag zwei Freunde von ihnen als Zeugen sowie deren Anwälte vom Menschenrechtszentrum am Eingang. »Augustín P. Velasco ist mein Neffe, Martín P. Domínguez mein Kumpel«, stellt Pérez die beiden vor. »Sie kamen, um zu bezeugen, dass wir zum Zeitpunkt des angeblichen Drogendeals in San Cristóbal in Wirklichkeit gerade den Polizisten in Cancuc aus dem Gebüsch zogen.« Doch so weit kommt es nicht. Während Pérez im Gefängnis gegen den Kopf geschlagen wird, damit er, Sántiz und Aguilar verschiedene Papiere unterschreiben, fährt draußen auf dem Parkplatz ein Polizeikonvoi vor. In Sekundenschnelle werden die beiden Zeugen von der Einheit festgenommen. Der anwesende Anwalt von Frayba fordert den Haftbefehl zu sehen, doch noch während er das Papier zu lesen beginnt, wird es ihm entrissen. Autotüren knallen und in Windeseile verschwindet der Konvoi samt Velasco und Domínguez.
Der folgende Prozess ist eine Farce. Es geht um den zu Tode gekommen Polizisten aus ihrer Heimatstadt Cancuc. »Erst bei der Anhörung erfuhren wir, dass uns Mord vorgeworfen wurde«, erzählt Pérez. Neben Sántiz ist er der Einzige, der Spanisch spricht und schreiben kann. Der offizielle Übersetzer im Prozess, spricht zwar Tsotsil, aber kein Tseltal, die Mayasprache der fünf Angeklagten. Es gab keine gerichtsmedizinische Untersuchung des Opfers, der ermittelnde Kommissar hatte nicht einmal den Tatort besichtigt. Einer unabhängigen Autopsie zufolge erlag der Polizist seinen Verletzungen, unterlassene Hilfeleistung der anderen Polizisten kann nicht ausgeschlossen werden. Trotz widersprüchlicher Aussagen der Kollegen des Verstorbenen und seiner Ehefrau wurden die »Fünf aus Cancuc«, wie sie in mexikanischen Medien mittlerweile heißen, im Mai 2023 zu 25 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 50 gefordert.
Kampf den Autobahnen

Für die Gefangenen und ihre Familien bricht eine Welt zusammen. Sántiz hingegen ist schnell klar, worum es bei der Aktion geht. »Sie haben es angekündigt. Ich wusste, dass mir so etwas eines Tages passieren würde.« Sántiz ist seit jeher politisch aktiv. Seit Jahrzehnten ist er in verschiedenen Zusammenhängen organisiert, um seine Gemeinde zu verteidigen. In der Kirche leitet er das Komitee für Menschenrechte und ist aktiv im Zapatista-nahen Nationalen Indigenen Kongress (CNI). Außerdem ist er engagiertes Mitglied bei Modevite, der Bewegung für die Verteidigung von Leben und Territorium, welche sich unter anderem gegen den Bau einer Autobahn durch den Landkreis Cancuc einsetzt.
Es handelt sich hierbei nicht nur um irgendeine Straße. Die Strecke von San Cristóbal nach Palenque, die sogenannte »Schnellstraße der Kulturen«, ist Teil des massiven Infrastrukturausbauplans für den Süden von Mexiko, welcher den Ausbau von Häfen, einer Ölraffinerie, Straßen und Zugstrecken beinhaltet. Darunter befindet sich auch der sogar hierzulande bekannte »Tren Maya«, der hier aufgrund von umstrittenen Investitionen der Deutschen Bahn kritisiert wurde.
Doch was ist für periphere Regionen wie Cancuc das Problem mit einer besseren Anbindung? Sántiz, Kleinbauer und gelernter Maurer, spielt mit einem Stift und schmunzelt angesichts solcher naiven Fragen: »Je besser die Straßen, umso mehr Narco, umso mehr Morde«, fasst er den Komplex lapidar zusammen. Mit Narco ist die organisierte Kriminalität gemeint. Das können sowohl kleinere lokal agierende Gruppierungen sein oder die großen bekannten mafiösen Drogenkartelle, die sich aktuell in einem blutigen Disput um die Territorialherrschaft im Bundesstaat Chiapas befinden.
Sántiz überspringt, was für ihn offensichtlich ist. Verbesserte Infrastruktur soll den Süden Mexikos wirtschaftlich attraktiver machen, sei es für den Tourismus oder den Bergbau. Zwölf Landkreise erklärten sich 2019 gegen den Bau der Schnellstraße, im Landkreis Cancuc allein 45 Gemeinden. Sie wissen, dass dies der Beginn der Zerstörung ihrer indigenen Lebensweise und ihres Territoriums ist. Doch der Protest der Bevölkerung wird begleitet von polizeilicher Repression und nicht zuletzt vom Bau neuer Kasernen der Nationalgarde entlang der Strecke. Roblero vom Menschenrechtszentrum Frayba erklärt, dass Chiapas seit 2018 verstärkt militarisiert würde. Dies diene offiziell der Abwehr der Kartelle als auch gegen die Migration, richte sich aber auch gegen die widerständigen Gemeinden, seien es zapatistische oder andere Organisationen. Die neuen Straßen sollen der Wirtschaft dienen. Sie würden jedoch auch die illegalen Geschäfte der Organisierten Kriminalität befeuern, wie an anderen Orten sichtbar ist. Das reicht vom unzulässigen Holzschlag, bis hin zum blutigen Handel mit Drogen und Menschen. Der Staat sowie Unternehmen als auch kriminelle Strukturen haben ein Interesse an verbesserten Transitrouten. Nicht zuletzt deshalb finden im Bundesstaat die blutigsten Auseinandersetzungen der Kartelle untereinander und mit dem Militär an wichtigen Kontenpunkten in der Grenzregion zu Guatemala oder nahe der Landeshauptstadt Tuxtla Gutiérrez statt. »Wir beobachten in Chiapas ein problematisches Interessen-Dreieck zwischen der Regierung, der Wirtschaft und der Organisierten Kriminalität«, so Roblero.
Sántiz, der seine politische Bildung in den Reihen der EZLN, der zapatistischen Bewegung, erfuhr, hatte diese Zusammenhänge mehrmals öffentlich deutlich gemacht. Besonders der Präsident des Landkreises Cancuc, Verfechter der Autobahn, hatte deshalb mehrmals gedroht, ihn ins Gefängnis zu bringen.
Vor zehn Jahren verließ Sántiz die zapatistische Organisation, »doch mein Herz kämpft weiter«. Viele seien in den letzten Jahren mit der Regierung gegangen, doch er könnte niemals Geld vom Staat annehmen. »Man muss sich zuhören. Und organisieren. Sonst wird das nichts.« Seine Frau lauscht gedankenabwesend den spanischen Worten ihres Mannes, die sie nicht versteht. Sie wippt ein Kleinkind auf ihren Beinen, drei Monate war es alt, als ihr Mann festgenommen wurde. »Die ganze Welt ist ja zurzeit betrunken.« Er setzt große Hoffnungen in die Neuauflage des Prozesses. Obwohl er das »starke« Mitglied der fünf Freunde ist, weiß auch er manchmal nicht weiter. Dann wendet er sich an Gott. Es ist schwer für ihn, dass es neben ihm selbst auch seine Freunde getroffen hat.
Knastalltag und Solidarität
Vor dem Gefängnis trifft sich eine kleine Gruppe von Aktivist*innen des Kollektivs »No estamos todxs« (spanisch: Wir sind nicht alle) für einen Solidaritätsbesuch bei den Fünf aus Cancuc. Seit 2010 begleitet die anarchistisch angehauchte Gruppe Betroffene der willkürlichen Staatsgewalt im Bundesstaat Chiapas. No estamos todxs besteht aus einigen lokalen Menschenrechtsverteidiger*innen und wird regelmäßig von internationalen Aktivist*innen gestärkt, die für ein paar Monate in San Cristóbal stranden. Viele kommen mit dem Ziel in die Stadt, um etwas über den berühmten zapatistischen Aufstand von 1994 zu lernen oder an der Menschenrechtsbeobachtung in bedrohten Gemeinden teilzunehmen, und stellen dann fest, dass es noch viele andere, manchmal wenig abenteuerlichere und dennoch wichtige Kämpfe gibt. Juanpi wiederum, ursprünglich aus Mexiko Stadt, ist seit gut zehn Jahren dabei.
Bevor es hineingeht, füllen sie Kaffee und Zucker zu gleichen Teilen in verschiedene Tüten: wertvolle Geschenke an die Freunde im Knast. »Die Schmerztabletten werden sie dir am Eingang abnehmen«, erklärt Juanpi einer jungen Ärztin aus dem Baskenland. »Und frag mal, ob du hier in dem Laden eine hellere Hose mieten kannst«, richtet er sich an den Genossen aus Griechenland. Schwarze Kleidung oder alles, was einer Uniform ähnelt, ist im Gefängnis nicht erlaubt. Juanpi, 40 Jahre alt, ist das geduldigste Mitglied der Gruppe und wird nicht müde, Monat für Monat den oftmals jungen Leuten die Grundlagen der Solidaritätsarbeit zu erklären. So auch an diesem Sonntag. »Die neuen Generationen politischer Aktivist*innen verschwinden, suchen sich andere Themen, wenn wir sie nicht ernst nehmen und unsere Kämpfe erklären.« Er, Juanpi, teilt nicht alle der neu aufkommenden linken Debatten in der Szene, doch die Ignoranz vieler »Alten« könnten sie sich in Chiapas nicht leisten.
Mindestens alle 14 Tage schauen sie bei den fünf Gefangenen aus Cancuc vorbei, so oft wie möglich fahren sie auch Gefangene in den entlegeneren Gefängnissen besuchen. Sie bringen Lebensmittel und Produkte mit, die im Knast nur teuer zu bekommen sind, doch vor allem geht es um gelebte Solidarität gegenüber den Eingesperrten: Nicht vergessen zu werden, gehört zu werden und um auch mal andere Geschichten zu hören. Im giftgrün gestrichenen Speisesaal, der dekoriert ist mit Bildern des letzten Abendmahls, Winnie Puh und Zitaten von Nelson Mandela, spielt ein italienischer junger Aktivist eine Partie Schach mit Velasco. Das geht auch ohne eine gemeinsame Sprache. Währenddessen schaut sich die Ärztin nebenbei die Nabelhernie von Aguilar an. Er ist besorgt deswegen, versteht nicht, was er hat. Pérez übersetzt. In der Gesundheitssprechstunde, die einmal die Woche stattfindet, hatte man ihm Antibiotika gegen die Schmerzen verschrieben. Die Baskin schüttelt ungläubig den Kopf.
Sprache ist ein essenzielles Thema. Die Verteidigung der fünf Gefangenen hatte nach dem Urteil von 2023 erfolgreich Revision eingelegt, da nachgewiesen werden konnte, dass die korrekte Übersetzung im Prozess nicht gewährleistet war. »Wir vergessen dabei immer, dass das ja auch außerhalb des Prozesses im Gefängnisalltag gilt«, kritisiert Juanpi. Ärzt*innen, Aufsichtspersonal, Sachbearbeiter*innen sprechen in der Regel keine der indigenen Sprachen, und im Kontext von Hierarchie und Gewalt ist es für die Gefangenen doppelt schwer, sich Gehör zu verschaffen.
Darüber hinaus sind die Bedingungen in mexikanischen Gefängnissen brutal und teuer. Dass die Ernährung eine komplett andere ist als die der ländlichen Bevölkerung, und viele daher unter Kolitis leiden, ist Juanpi zufolge nur eines der Probleme. Andere Lebensmittel sowie sämtliche Hygieneartikel werden nicht vom Staat gestellt und hinter Gittern teuer gehandelt. »Letztlich ist es ein Spiegel des Systems von draußen«, so der Aktivist. In den überbelegten Gefängnissen herrsche ein System korrupter Knasthierarchie, an deren unterstem Ende sich stets die Neuankömmlinge befinden. »Für alles muss man zahlen: Für die Matratze, das Recht zu kochen oder um nicht regelmäßig vermöbelt zu werden.« Knapp 20 000 Pesos muss ein*e Gefangene*r beim Betreten der Anstalt an die Anführer und für ein Bett hinblättern. Bei einem durchschnittlichen Einkommen auf dem Land von 3000 Pesos monatlich, liegt das Dilemma zwischen Schulden für die Familie draußen oder Schlägen drinnen. Die Gefängnisleitung ist im Bilde, profitiere laut Juanpi selbst von dem System.
Schwere liegt über dem Abschied der Aktivist*innen an jenem Nachmittag. Dominguez bekommt feuchte Augen, Sonntage sind besonders anstrengend für ihn. Während die meisten Besuch von ihren Familien bekommen, bleibt er alleine. Seine Frau hat ihn verlassen, seine Kinder leben nun getrennt voneinander bei verschiedenen Verwandten.
Bürokratie als Waffe
Die Neuverhandlung mit einer neuen, jungen Richterin finden seit Anfang April dieses Jahres statt. Die Staatsanwaltschaft versucht den Prozess herauszuzögern. Die Sitzungen werden immer wieder vertagt, mal fehlt der Übersetzer, mal der Staatsanwalt selbst. Doch inhaltlich läuft es gut. Keine*r der geladenen Zeug*innen belastet die Fünf aus Cancuc direkt. Die Polizisten widersprechen sich, können sich nicht einigen, ob das Seil, mit dem der Verstorbene gefesselt gewesen sei nun gelb oder blau war. Die Anwälte, und auch die Mitglieder von No estamos todxs und Frayba, die im Publikum sitzen, schöpfen mit jedem Verhandlungstag mehr Hoffnung. Doch es kommt anders. Das Urteil vom Vorjahr wird bestätigt, 25 Jahre für alle fünf.
»Es ist klar, dass sie sie freilassen müssen. Wenn nicht in dieser Revision, dann in der nächsten. Die Aussagen sind eindeutig«, insistiert Roblero. Nun stünde endlich der Weg über höhere Gerichte offen. Doch der lange Weg durch die bürokratischen Labyrinthe des Justizsystems sei ein weiteres Mittel der Repression, so Robero weiter: »Statt die Fehler und Machenschaften der Staatsanwaltschaft anzuerkennen, sollen die Betroffenen ausgelaugt werden.« Daher sei es, so Juanpi, nun mehr denn je wichtig, die Gefangenen nicht alleine zu lassen. Dutzende Gruppen aus verschiedenen Ecken der Welt hatten in den letzten Wochen Solidaritätsvideos gesandt. Pérez betont, dass sie darüber unendlich dankbar sind. »Sie erinnern die Regierung, aber auch uns und vor allem unsere Familien und Kinder daran, dass wir nicht alleine sind. Und dass wir im Recht sind.«
So geht der Kampf um Gerechtigkeit nun in die nächste Runde. Juanpi zeigt sich unermüdlich: »Bisher haben wir sie alle freibekommen.«
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.