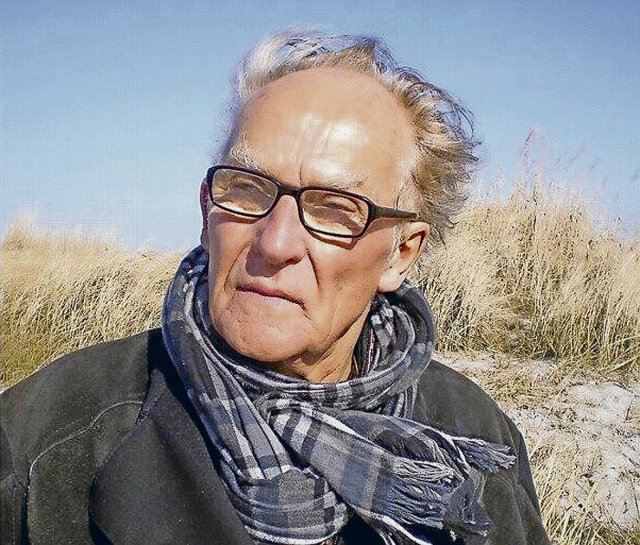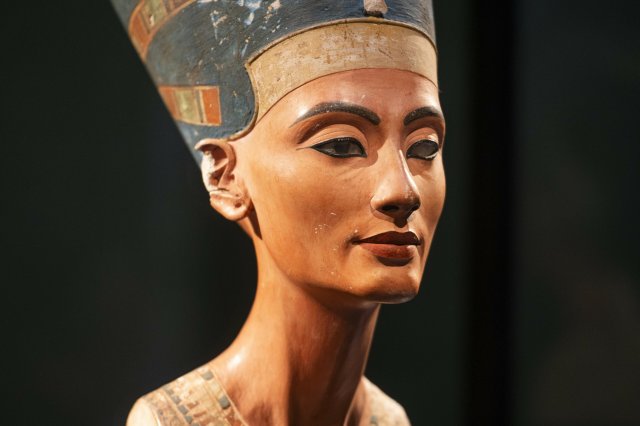- Kultur
- Marokko
Leg dich in den Wind
Wie sieht Marokkos Himmel am Atlantik aus? Ein Besuch in der alten Hafen- und Hippiestadt Essaouira

Das Licht. Von morgens bis abends Fotografenlicht. Ein Licht, das durch einen samtblauen, makellos gewobenen Paravent strömt. Das Blau. Nie zuvor haben wir ein solches Blau gesehen – ein Blau, das der Welt schmeichelt und sie gar rühmt, als sei sie eine ringsum wohlgeratene. Was ist das für ein Blau? Auf den einschlägigen Farbpaletten finden wir es nicht so recht. Schieferblau? Da fehlt ein beigemischter Ton. Am ehesten vielleicht eine Mixtur aus Periwinkle und Fliederblau. Oder doch einfach Himmelblau?
Und das Weiß der Möwen, deren untere Handschwingen an den Spitzen schwarz abgesetzt und deren Mantel und Armdecken in Betongrau gehalten sind. Gemalte Kaventsmänner, jede Linie und Fläche ihres Gewandes sitzt an der richtigen Stelle. Sie nisten auf den Dächern der Medina und stehlen den Fischern Teile ihres Fangs. Einmal beobachteten wir, wie ein Mann, der Seeaale und anderes Meeresgetier ausnahm, einen Hummer nach den schamlosen Nassauern warf.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Es sind vermutlich Mittelmeermöwen, die unseren Heringsmöwen, die auch an der nordafrikanischen Küste überwintern, zum Verwechseln ähneln. Nachts kreisen sie über der lichtabstrahlenden Altstadt von Essaouira und wirken wie gigantische Glühwürmchen. In den hellen Stunden schweben sie unermüdlich mühelos durch den Äther, sie schwimmen in ihm, kippen unvermittelt nach hierhin und dorthin ab, sie steigen auf und lassen sich fallen, stürzen hinab gleich Steinen, sie wippen hin und her, tarieren Strömungen, pfeilen dahin, zirkeln das ihnen zugedachte Element aus und beschreiben Steilkurven. Ihr quietschender, gequetschter Ruf scheint Freude und Anstrengung zugleich auszudrücken, begleitet von den unendlichen Kundgaben der Spatzen, die an der marokkanischen Atlantikküste entschieden variantenreicher, farbiger singen als ihre einfältigen mitteleuropäischen Artgenossen.
Während der etwa vierstündigen Fahrt von Agadir nach Essaouira, Richtung Norden über die N 1, die die von der ewigen Sonne gegerbten Berge zum Teil in Serpentinen bewältigt, segelt über den Ausläufern des Hohen Atlas ein Milan. Kite heißt er auf Englisch. Links und rechts sind Arganien über die ockerfarbenen Hänge und Ebenen gestreut, sie gedeihen ausschließlich im Südwesten Marokkos – buschig ausladende, knorrige, immergrüne, ans aride Klima angepasste Gewächse, die das berühmte Öl liefern und allerdings die langanhaltende Dürre offenbar trotz der Fähigkeit, in eine Art Trockenschlaf zu fallen, vielerorts nicht mehr wegstecken. In manchen Gegenden ist jeder zweite Eisenholzbaum aschgrau – ein beklemmender Anblick –, und hinzu kommt die nicht zu stoppende Rodung, dieser kulturübergreifende »Menschenunfug« (Alexander von Humboldt).
Überall warten Bauruinen auf eine Zukunft, die Felder sind mit Plastikmüll übersät und mit Schutthaufen verunziert, abgemagerte Ziegen, Esel und Hunde streifen umher, alte Frauen sitzen im Schatten. Wovon leben die Leute hier? Wovon bloß?
»Essaouira is the windy city of Africa«, sagt unser ungeheuer freundlicher Taxifahrer Said. Stets aus Nordost fegt der auflandige Passat über den Strand und die Stadt, man kann sich am Wasser stehend in ihn hineinlegen und fällt nicht um. Ein Käppi aufzubehalten, ist unmöglich, praktikabel wäre eventuell ein Motorradhelm. Auf der Terrasse der Bar »beach & friends« nagelt es sogar das Bierglas um. Nach zwei Tagen ist man geneigt, entweder ein Traktat wider den Wind herunterzuschrubben oder eine Ausbildung zum Windwissenschaftler zu absolvieren, um mit den wüsten Wallungen, der zölestischen Peitsche fertigzuwerden: Wo hinhocken? In welcher Ecke trinken?
Der hellbraune Sandstrand liegt wie ein ausgerollter Strudelteig vor uns und dem smaragdgrün-bleigrauen Atlantik, am Horizont buckelt eine lang gestreckte Hügelkette herum. Der Reiseführer »Morocco – The Rough Guide« (London 1998) preist die sogenannte Destination als »immense wind-swept beach« an, als Dorado für Kitesurfer, die wie in einen Wirbel geratene, hilflose Insekten an ihren Leinen und bunten Drachen hängen und dahintreiben. Die Angelegenheit sei nicht »unrisikovoll« (Karl-Heinz Rummenigge), hören wir. Neulich sei, erzählen unsere Gastgeber, ein Kitesurfer direkt neben ihnen auf den Strand gekracht und habe sich im Sturz mit einer Leine ein Ohr abgerissen. Seine Freundin habe, bis die Ambulanz gekommen sei, derart hysterisch herumgeschrien, dass sie ihr am liebsten eine Ohrfeige verpasst hätten.
Essaouira war ein Mekka der Hippies. Die Annalen verzeichnen Aufenthalte der Stones, von Frank Zappa und Jim Morrison, zumal von Jimi Hendrix. 1969 verbrachte er elf Tage hier und soll den somnambulen Song »Castles Made Of Sand« komponiert haben, dieses fiebrige Stück über die schmerzliche Fragilität und katastrophale Kontingenz des Lebens, der Liebe, aller Bindungen, in das er ein flirrendes, rätselhaftes Reverse-Solo hineinpflanzte. »And so castles made of sand/ Fall in[to] the sea eventually.« Das kann nicht sein. »Castles Made Of Sand« war bereits 1967 erschienen. Doch Mythen haben ihr eigenes Recht, und sie erfüllen die Gassen der Medina, der Altstadt, in der sie mehr denn zwei Jahrhunderte lang koexistierten: die Muslime, die Juden, die Christen.
Draußen die Weite, drinnen die Enge. Wir sind privilegiert. Wir wohnen in einem klassischen Riad, einem maurischen Hofhaus, in der Nähe des Stadttors Bab Marrakesch. Viele dieser Unterkünfte befinden sich mittlerweile in den Händen von Europäern und wurden luxuriös saniert. Es sind Stimmen zu vernehmen, die befürchten, dass bald kein Einheimischer mehr hier wird leben können.
Der Riad ist in ein Gewirr aus ineinander verkanteten Steinwürfeln hineingeschachtelt. Anders als in der abendländischen Architektur zeigt kein Fenster auf die Straße. Der schachtartige Patio hat niemals ein Dach. Balustraden aus filigranen Säulen zieren die Terrassen, die drei Etagen sind über schmale, steile Treppen zugänglich. Tritt man vor die obligatorisch blaue Tür – das Blau, heißt es, vertreibe böse Geister –, umklammern einen hoch aufschießende weiße Wände, die die Wärme abwehren und von denen der Putz abblättert. Bis vor einigen Jahren flossen durch die Gassen, in denen manchmal keine zwei Menschen nebeneinander und die hölzernen Handkarren gerade so hindurchpassen, noch die Abwässer. Es sind »Gässchen«, schreibt Tahar Ben Jelloun in seinem großartigen Roman »Sohn ihres Vaters« (Reinbek 1989), »in denen sich Tiere und Verrückte wie in einer Falle fangen«, vor allem Katzen, Katzen, Katzen, dürre Katzen, die in Körben, auf Simsen, auf Schwellen und auf dem Pflaster dösen. Die autofreie Medina ist Welterbestätte. Vier mit dem Lineal gezogene Achsen – eine Rarität im Orient – gliedern sie.
Essaouira, das seit der portugiesischen Besetzung Anfang des 16. Jahrhunderts den Namen Mogador trug, war früher das Tor Timbuktus, der größte Hafen Nordafrikas. Die Fischerei steuert trotz des boomenden Tourismus nach wie vor 40 Prozent zu den Einkünften der weitgehend armen Bevölkerung bei. Im Port, in dessen Nähe sich Orson Welles mit der Verfilmung des »Othello« herumquälte – ein reizloser Platz erinnert daran –, sind fuderweise blaue Boote vertäut, und unterm Himmelszelt wabert eine Wolke maritimer Gerüche, in die immerfort der Wind hineinstößt.
Essaouira: »die Eingeschlossene«. Im 18. Jahrhundert ließ Sultan Sidi Mohamed ben Abdallah die Festungsanlagen weiter ausbauen. Im Nordwesten begrenzt die Medina ein massiger, an der Fassade vom Passat zernagter Wehrturm. Die in Spanien gegossenen Kanonen linsen zwischen den Zinnen der Stadtmauer, der Sqala de la Kasbah, über dunkel schattierte schroffe Felsen hinweg. Hier wurden einige Episoden von »Game Of Thrones« gedreht.
Wir schlendern – die Gassen leeren sich mählich – zum »Caravane Café« in der Rue du Qadi Ayad. Ein Trio tritt auf und führt Gnawa- oder, französisch, Gnaoua-Musik auf, die Nachfahren westafrikanischer schwarzer Sklaven in Marokko kultiviert haben. Der Raum dampft, vibriert, pulsiert, die junge Frau an der Gimbri, einer dreisaitigen Langhalslaute, zaubert betörende synkopierte Bassläufe herbei, und zwei Burschen in himmelblauen Kostümen begleiten sie mit metallenen Schellen – den Qaraqib –, tanzen dazu wie mystisch entrückt und wirbeln durch die Luft gleich schwerelosen Wesen.
Man kann es mit den Ohren greifen: Nun ist klar, wo die Ursprünge des Jazz liegen. Und wo Frank Zappa sein fabelhaftes Zeug herhat. Die Genies sind unter uns, im Globalen Süden. Es kennt sie nur niemand.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.