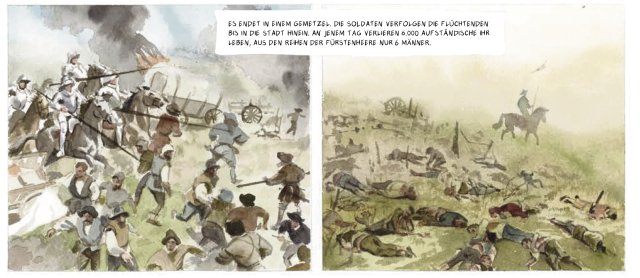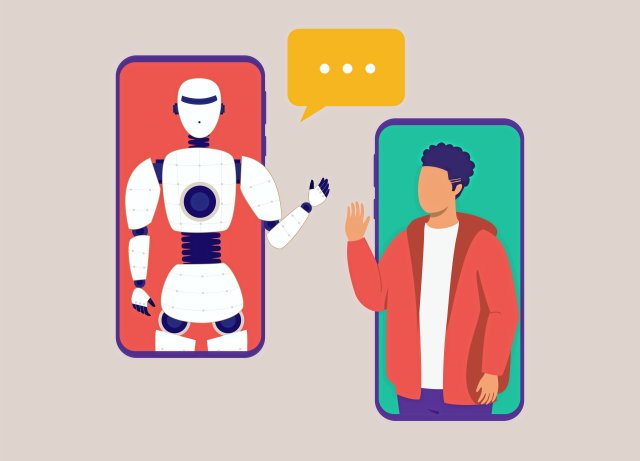- Wissen
- Vergangene Zukunft
Gegen den Pfeil
Entschleunigung, Akzelerationismus und verordnete Zeit

Flashback. Zeitlupe. Flashforward. Zeitraffer. Das Kino ist da, um den Lauf der Dinge aufzumischen – in regressiven Zeiten eine willkommene Unterbrechung. »Haben Sie in diesen Tagen des Krieges und der Kriegsgerüchte nicht auch schon einmal von einem Ort geträumt, an dem es Frieden und Sicherheit gibt und wo das Leben kein Kampf, sondern eine dauerhafte Freude ist?« So lautet der Vorspann von Frank Capras Kultfilm »Lost Horizon« aus dem Jahr 1937. Die Geschichte erzählt von Westlern, die nach einem Flugzeugabsturz im Himalaya in die Klostergemeinde Shangri-La aufgenommen werden. Vom Rest der Welt total abgeschieden, haben dort Frauen und Männer das irdische Eden verwirklicht. Ähnlich wie in Bildern der maoistischen Kulturrevolution sieht man glückliche, uniformierte Menschen, die bei der kollektiven Arbeit singen. Die Legende von Shangri-La hat Tibet als Sehnsuchtsort popularisiert.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.
Im Film mischt sich aber die buddhistische Exotik mit Elementen europäischer Kulturavantgarden. Die Utopie ist vor allem eine Uchronie. Der Takt des gewaltfreien Lebens hat sich derart verlangsamt, dass alle viel jünger aussehen, als sie biologisch sind, und viel länger leben als Normalsterbliche. Nur enthält eine gute Utopie ihre eigene Kritik, hier in Gestalt von Maria. Die Bewohnerin sieht wie eine Zwanzigjährige aus, ist aber viermal so alt. Und hat nur eines im Kopf: Nur weg vom paradiesischen Stillstand! Die ewige Wiederkehr des Gleichen ist ihr unerträglich. Sie überredet einen der Gäste mit ihr zu fliehen, doch kaum hat sie Shangri-La verlassen, altert sie zusehends und stirbt. Das war der Preis für ihre Freiheit.
Eine diametral entgegengesetzte Erzählung bietet der Science-Fiction-Film »Things to come«, wenige Monate vor »Lost Paradise« nach einem Drehbuch von H.G. Wells gedreht. War der Erfinder der Zeitmaschine wirklich visionär? Der Film beginnt im Zukunftsjahr 1940 mit dem Ausbruch eines Weltkriegs und Luftangriffen auf Städte. Nach Jahrzehnten der Zerstörung und der Stagnation übernimmt dann eine Riege von Technokraten die Führung. Den wohlwollenden Diktatoren geht es darum, Unwissenheit und Beschränkungen in immer schnellerem Tempo zu überwinden. Die unterirdisch lebende Bevölkerung wird nach rationalistischen Prinzipien umerzogen. Um Kriege zu verbannen, wird ein friedliches Ziel angestrebt: Die Eroberung des Weltalls – ein Programm für die Ewigkeit. »Und wenn wir all die Mysterien der Zeit erobert haben, stehen wir immer noch am Anfang«, erklärt der Chefingenieur fanatisch. Nach einem Gespräch zu urteilen, das Wells kurz vor »Things to come« mit Stalin hatte, entsprechen die dargestellten Zustände genau seiner Auffassung von Sozialismus. Doch auch in dieser Erzählung regt sich Widerstand. Von einem Künstler aufgewiegelt verlangt ein Mob einen Fortschrittsstopp: »Wir wollen nicht, dass eure Erfindungen unser Leben ständig verändern!« Noch kann die erste Rakete nach dem Mond starten, ehe die Maschinenstürmer den Weltraumbahnhof besetzen. Wie die Geschichte endet, lässt der Film offen.
Zu einer Epoche, als sich die Weltkrise zuspitzt und in Vorahnung der heranrückenden Katastrophe werden also zwei alternative Zeitmodelle vorgestellt: hier Entschleunigung, dort Akzelerationismus. Doch obwohl die Autoren offenbar eine andere Absicht hatten, neigt man in beiden Fällen dazu, sich auf die Seite der antiutopischen Minderheit zu stellen. Denn ganz gleich, ob das verordnete Tempo schleppend oder rasant ist, die humane Zeit ist die Zeit der Negation.
Guillaume Paoli ist Philosoph und Essayist. 2024 gewann er für sein Buch »Müll und Geist« den Günther-Anders-Preis für kritisches Denken.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.