- Kultur
- Sowjetunion
Im Sonderzug nach Leningrad
Truman Capote gibt einen seltenen Einblick in die UdSSR der 50er Jahre

Die letzten Tage des Jahres 1955 verbringt Truman Capote in der UdSSR. Stalin ist seit drei Jahren tot, doch der Kalte Krieg ist weiterhin so kalt wie die Außentemperaturen: zweistellig unter null. Capote gehört als Journalist zum Begleittross zum Ensemble der Gershwin-Oper »Porgy and Bess«, die in Moskau und Leningrad aufgeführt werden soll. Die Oper ist schon zwei Jahrzehnte alt, doch es ist der erste Kulturaustausch zwischen den USA und der UdSSR, was sie noch einmal in die Medien bringt.
Und es ist Capotes erster »Tatsachenroman«, eine neue Form des Journalismus, die er, von der Literatur kommend, später mit »Kaltblütig« zur Meisterschaft bringen wird. Sein russischer Reisebericht knüpft an eine Tradition an: Vor allem in den 30er Jahren hatten linke Schriftsteller wie beispielsweise Oskar Maria Graf oder Lion Feuchtwanger die Sowjetunion bereist und dann Berichte geliefert, die in der Regel von ihrer Zustimmung bis Euphorie kündeten. Selbst Stalins Terror mochte diese Hoffnungen auf eine heilsbringende Zukunft des Kommunismus nicht dämpfen.
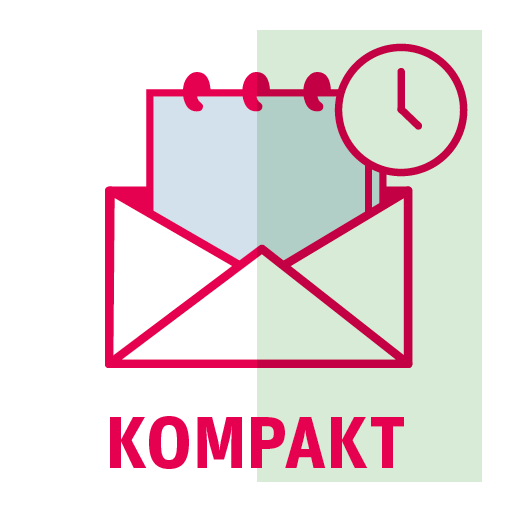
Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.
Capote aber hat noch nie an die Weltrevolution geglaubt. Politisch möchte er sich nicht äußern, weiß aber auch, dass die sowjetischen Gastgeber andere Erwartungen haben. So werden die afroamerikanischen Ensemblemitglieder darauf angesprochen, wie es sich denn anfühle, in einem Land zu leben, das weltweit als Musterdemokratie dastehen möchte, aber in einzelnen Bundesstaaten die sogenannte Rassentrennung praktiziert.
Die Künstlertruppe reist im Sonderzug und logiert an den allerersten Adressen. In der Eisenbahn, im Hotel, bei Pressekonferenzen und Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten achten jede Menge Aufpasser darauf, dass die Kontakte zur einheimischen Bevölkerung nicht zu eng werden. Alles beste Voraussetzungen für einen abgedroschenen Bericht? Nicht mit Capote! Denn der kann einfach nicht langweilig schreiben. Die Hälfte der Handlung spielt im Zug, die einzigen Schauplätze auf festem Boden sind, neben den Bahnhöfen, Ostberlin und Leningrad (Moskau lässt Capote aus). Öde wird es nie: Mit wenigen Sätzen gelingt es dem Autor, mindestens zwei Dutzend Mitreisende zu charakterisieren: US-amerikanische Künstler, Hilfskräfte, Manager, Journalisten; sowjetische Betreuer, Dolmetscher, Uniformierte und den einen oder anderen KGB-Agenten.
Womöglich ist Capotes Leichtigkeit der, trotz aller politischen Widrigkeiten, überraschend ungezwungenen Atmosphäre geschuldet. Beim sogenannten Sowjetmenschen kehrt er, nie wertend, rein journalistisch beschreibend, die menschliche Seite zuverlässig hervor. Einmal auch aus Trotteligkeit: Als Capote sich noch über den scheinbaren Verlust einer gerade teuer erstandenen Pelzmütze grämt – an welchem Ort kann er sie nur vergessen haben? – ist es ausgerechnet der KGB-Mann, der sie aufliest und ihm wiedergibt.
Kalter Krieg? Der warme Empfang, den das Publikum den Künstlern gewährt und die Zaungäste der gesamten Gästeschar bereiten, ließe sich auch als Umsetzung des von Chruschtschow postulierten politischen Tauwetters deuten. Capote würde nie solche Schlüsse ziehen. Vermutlich ist ihm Ilja Ehrenburgs Romantitel, dem die Kampagne ihren Namen verliehen hat, kein Begriff.
Am meisten menschelt es in Leningrad. Ein Funktionär interessiert sich sehr für die blonde Assistentin des US-Managements, schenkt ihr einen Gummihasen und lässt nicht locker. »Er will mit mir tanzen gehen«, klärt sie Capote auf und fragt: »Meinst du, das ist in Ordnung?« Die Antwort gibt sie selbst: »Ich meine, solange es beim Tanzen bleibt.« Ungefragt fügt sie hinzu: »Und wenn nicht, auch egal.« Was daraus wurde, verrät Capote nicht.
Mit demselben Funktionär besucht Capote eine Arbeiterkneipe in Leningrad. Sie ist fast so lange geöffnet wie eine New Yorker Bar, doch die Wirkung des Alkohols scheint hier ungleich mächtiger: Neben dem Kater bleibt Truman die Erinnerung an ein Erlebnis mit allen Sinnen, »als hätte man mich in eine gut ausgeleuchtete Bärengrube gestoßen«. Die journalistische Distanz ist verflogen, von Zurückhaltung keine Spur mehr: »Ich stand auf einmal in den körperwarmen, bierschweren Ausdünstungen von circa einhundert brüllenden, streitenden, rauflustigen Männern, die rochen wie ein nasser Fuchs. Zu einem Dutzend saßen sie jeweils um einen der sechs Tische.«
Und erst das Personal! Trumans Objektivität schwindet endgültig angesichts der »einzigen Frauen im Raum«, seiner Wahrnehmung nach »drei identische Kellnerinnen von robuster Bauart, etwa so breit wie hoch und mit runden, platten Bratpfannengesichtern.« Auf politische Korrektheit, dem Übersetzer Marcus Ingendaay sei Dank, wird auch in der deutschen Version verzichtet. Am Ende aber steigt dieses Trio in Trumans Ansehen: Sind sie es doch, die alles im Griff haben und für einen rundum gelungenen Abend sorgen.
»Die Musen sprechen«, der Titel seines Buchs spielt auf die Begrüßungsrede eines Mitarbeiters des sowjetischen Kulturministeriums an, in der er formulierte: »Wenn die Kanonen zu hören sind, schweigen die Musen. Wenn die Kanonen schweigen, hört man die Musen.« Auch zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Innere der UdSSR dem zeitgenössischen US-Bürger ähnlich fern wie heute Nordkorea. Capotes Blick ist distanziert, aber klar; seine Haltung neutral, doch nicht teilnahmslos: Die Leserschaft soll sich ein eigenes Urteil bilden. So ist dieses Reportagebuch auch sieben Jahrzehnte später immer noch eine spannende Lektüre.
Truman Capote: Die Musen sprechen. A. d. amerik. Engl. Von Marcus Ingendaay. Kein & Aber, 192 S., br., 13 €.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.







