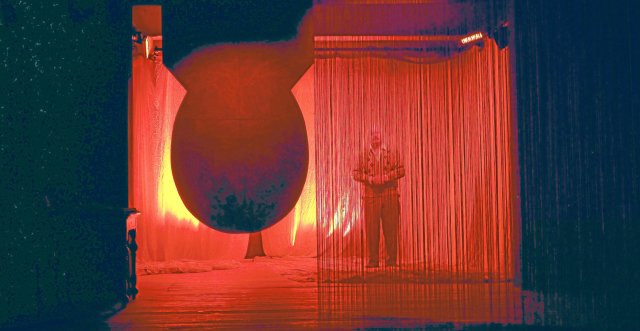- Berlin
- Geschichte der Arbeiterbewegung
Demokratisierung im Ausnahmezustand
Vor 80 Jahren begann in Berlin der Neuaufbau der Gewerkschaften. Es war ein Prozess der Entnazifizierung mit gesellschaftlichem Veränderungsanspruch

Alles begann damit, dass die Kolleg*innen wieder Kontakt zueinander aufnahmen. Schon »gleich nach Beendigung der Kampftätigkeit« im Mai, berichtete der Eisenbahner Discher am 25. Juli 1945, habe er sich »mit dem Koll. Sommer in Verbindung gesetzt und auf dessen Rat frühzeitig Vertrauensmänner und eine Zellenleitung gebildet«. Gelegenheit dazu gab ihm eine Sitzung des Bezirksausschusses Charlottenburg, Teil des Freien Deutschen Gewerkschaftsbunds Groß-Berlin (FDGB), der zehn Tage zuvor gegründet worden war. Nur wenige Wochen nach dem Ende des Nationalsozialismus und der deutschen Kapitulation waren bereits 70 Vertrauensleute aus Charlottenburger Betrieben erschienen, die wiederum eine Vielzahl von organisierten Kolleg*innen repräsentierten.
Doppelte Neugründung
Im Sommer 1945 war das nationalsozialistische Deutschland besiegt und Berlin seine ehemalige Hauptstadt. Die Stadt, vormals und immer noch eines der politischen und industriellen Zentren, war nun in vier Sektoren aufgeteilt, die unter militärischer Administration der Alliierten standen. Die vom Eisenbahner Discher erwähnten Kämpfe zwischen Wehrmacht und Roter Armee und die vorhergehenden Luftangriffe hatten Berlin großflächig zerstört. Damit war auch die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum, Heizstoffen und ausreichender Nahrung ein akutes Problem. Zu den materiellen Nöten kamen von Nationalsozialismus und Krieg zerstörte Gesellschaftsstrukturen und ebenso zerstörte Menschen. In diesem materiellen und sozialen Ausnahmezustand sollten die Gewerkschaften, ihre Basismitglieder wie die alten Funktionär*innen, eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau solidarischer und demokratischer Lebensformen spielen. Im Ausnahmezustand des Postfaschismus trugen sie ihren Teil dazu bei, die Betriebe zu demokratisieren und zu entnazifizieren. Sie bildeten schnell die mit Abstand größte antifaschistische Mitgliederorganisation.
Dabei waren die Charlottenburger Gewerkschafter*innen nicht einmal die Schnellsten. Bereits am 17. Mai 1945 fanden sich unter Leitung des vom Maschinenbauer zum Ingenieur aufgestiegenen SPD-Mitglieds Rudolf Wissell Gewerkschaftsfunktionär*innen der Bewag zusammen, der Berliner Elektrizitätswerke. Im Verwaltungsgebäude in der Luisenstraße im Stadtzentrum sprach neben Wissell auch der Kollege Lucas, der zu den organisatorischen Plänen ausführte: »Das, was wir aufbauen wollen, soll auf gleicher demokratischer Grundlage geschehen, wie wir es 1933 verlassen haben.« Lucas war vor 1933 Mitglied des Betriebsrats gewesen und wurde nun neben seiner Eigenschaft als Vorsitzender des »Arbeiter- und Angestelltenrates« auch in einen Beirat gewählt, der bei der Geschäftsleitung auf die Entlassung von »Pgs«, also ehemaligen Parteigenossen der NSDAP, drängen sollte.
Zum Tätigkeitsfeld der »Säuberung der Faschisten« berichtete auch der »Verband für Eisenbahn, Post und Fernmeldewesen« dem vorläufigen Vorstand des FDGB Groß-Berlin im Juli 1945 stolz, die Gewerkschafter der Post hätten damit »bereits am 2.5.45« begonnen. Ein kurz darauf eingerichteter Ausschuss habe systematisch in allen Dienststellen die »aktiven faschistischen Elemente ... ausgeschaltet«. Viele Mitglieder der Gewerkschaften hatten sich unter großem Risiko und mit der Folge langer Gefängnis- und KZ-Haft am Widerstand gegen das NS-Regime beteiligt. Die Entnazifizierung war zugleich eine Frage der Demokratisierung im Postfaschismus und eine sehr persönliche Angelegenheit.

Den aktiven Kernen von gewerkschaftlich organisierten und denkenden Kolleg*innen in den Betrieben standen allerdings – das mussten die entstehenden Gewerkschaftsverbände feststellen – Apathie und Gegnerschaft vieler anderer Arbeiter*innen gegenüber. Die faschistische Gesellschaftsformierung von »Deutscher Arbeitsfront« (DAF) und »Betriebsführer« und dessen »Gefolgschaft« im Betrieb war erst seit wenigen Wochen Vergangenheit. Im August 1945 berichtete der Bezirksausschuss Kreuzberg dem vorläufigen Vorstand vom »Fiasko« des Versuchs, allgemeine Versammlungen der Lehrer, der Holzarbeiter und im Baugewerbe durchzuführen – die wenigen Teilnehmer*innen zeigten »absolute Gleichgültigkeit, beinahe Feindseligkeit«. Die oft geäußerte Sorge des Nachlebens der nationalsozialistischen Ideologie insbesondere unter der jungen Generation wurde in bestürzten Äußerungen über die »katastrophale geistige Verwahrlosung der Kinder« dokumentiert.
Allerdings konnte man auf der Organisationsebene von größeren Betrieben und unter anderem im Metallbereich bessere Resultate erzielen. Auch der Verbandsaufbau in den Branchen und Stadtteilen war in den nächsten Monaten erfolgreich – in beeindruckender Geschwindigkeit, gemessen daran, dass das nationalsozialistische Regime und ein Jahrzehnt Volksgemeinschaft gerade einmal wenige Wochen her waren und dass deren ideologischen und psychischen Folgen weiter bestanden. Die erwähnten Zerstörungen des Krieges hatten zudem Verkehr und Kommunikationsstrukturen weitgehend lahmgelegt. Wie viele andere Einzelgewerkschaften meldete der »Verband der Metallarbeiter« trotzdem schon im Juli 1945 funktionierende »Bezirksverbandsleitungen«, die an der Erfassung der Mitglieder und der Wahl von Vertrauensleuten arbeiteten, sowie eine »vorläufige Verbandsleitung«. Die selbstorganisierten Betriebsstrukturen und die neuen Gewerkschaftsverbände schufen im Alltag, in der Öffentlichkeit und im neu entstehenden politischen Gerüst der Stadt Räume der Selbstbestimmung und demokratische Lebensformen. Sie ermöglichten es, diese Formen des Lebens wieder einzuüben, zum Schweigen gebrachte Forderungen wieder aufzugreifen und neue Visionen für eine soziale und solidarische Gesellschaft zu entwickeln.
Die Leitungen der Verbände und auch der vorläufige Vorstand bestanden meist paritätisch aus der gleichen Anzahl von SPD- und KPD-Gewerkschafter*innen und einer kleinen Minderheit christlicher Delegierter. Dies war das Ergebnis der Verhandlungen von sozialdemokratischen, christlichen und kommunistischen Gewerkschaftern seit Anfang Juni – bekannte Funktionäre der Weimarer Republik wie Jakob Kaiser (Zentrum), Hermann Schlimme (SPD), Roman Chwalek (KPD), dazu der frisch aus Moskau zurückgekehrte Walter Ulbricht (KPD). Die Festlegung auf einen gleichen Anteil von kommunistischen und sozialdemokratischen Partei-Vertreter*innen zeigte direkt die Machtstellung der KPD in Berlin an, die auf die Rückendeckung der sowjetischen Besatzungsmacht zählen konnte. Denn im Vergleich zur Weimarer Republik, als die KPD-Gründung der Revolutionären Gewerkschaftsopposition (RGO) gegenüber dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB) nur eine Minderheit der Arbeiter*innen vertreten konnte, war die garantierte Parität ein gewaltiger Einflussgewinn. Ausgangspunkt dieser Entwicklungen war die Überzeugung aller Beteiligten, dass nach den politischen Spaltungen der Weimarer Republik, die zum Sieg der NSDAP beigetragen hatten, »Gewerkschaftseinheit« zwingend geboten war.
Arbeiterpolitik im Handgemenge
Zwei zentrale Probleme für die Gewerkschaften stellten die Versorgungssituation und die Demontagen dar. In Berlin herrschte Mangel an Nahrung, Wohnraum, Heizmaterial, Strom, Kleidung und sogar Haushaltsgegenständen. Bei der ersten größeren Berliner Gewerkschaftstagung am 30. Juli 1945 wurde entsprechend von Fritz Rettmann (KPD) für den Metallarbeiterverband eine Initiative der Siemens-Belegschaft hervorgehoben. Die »Berliner Zeitung« – herausgegeben von der sowjetischen Besatzungsmacht – berichtete, man stelle »Kochtöpfe, Herde, Sensen, Wagen« und ähnliches her; der Verband der Bekleidungsarbeiter sehe eine seiner Hauptaufgaben in der Beschaffung von »Winterbekleidung für die Bevölkerung«. Mehrere Einzelgewerkschaften beteiligten sich zudem an der »Ernteaktion«: Mitte Juli wurde dem vorläufigen Vorstand berichtet, dass der Metallarbeiterverband im Bezirk Reinickendorf eine mobile Reparaturwerkstatt eingerichtet und eine »Sammelaktion für Sensen, Sicheln, Schärfsteine, Spaten« und andere Werkzeuge begonnen habe. In Spandau stellte man »Wagen für Stein- und Mülltransport« her, der Verband der technischen Angestellten und Werkmeister meldete, er arbeite an »Fertigungsmethoden« für Sicheln und Kartoffelhacken.
Die Demontagen waren als Teil der Reparationen an die Alliierten Ergebnis der Kriegsniederlage und wurden insbesondere von der sowjetischen Besatzungsmacht in dramatischem Ausmaß durchgeführt. Am 22. Juni 1945 wandte sich der »Vorbereitende Ausschuss zur Bildung der Gewerkschaften im Betrieb der AEG« aus dem östlichen Stadtbezirk Treptow an die »Alliierte Kommandantura«, die oberste Besatzungsadministration. Man habe, schrieben die Kollegen, seit dem Mai 1945 mit den von Kriegsschäden verschonten Maschinen versucht, die Rüstungsproduktion des Werks auf den »rein zivilen Sektor« umzustellen. Außerdem plane man, eine »Rundfunk-Reparaturwerkstätte« einzurichten und einen preisgünstigen »Kleinempfänger« zu produzieren. Alle Pläne würden aber durch eine nun angekündigte Demontage des Werks, den »totalen Verlagerungsbefehl«, unmöglich gemacht. Die Ausschussmitglieder baten daher »im Namen der antifaschistischen Arbeiterschaft« darum, zumindest zwölf bis 14 Prozent der Maschinen von der Demontage auszunehmen, um »für 1000 Menschen eine Arbeitsmöglichkeit zu schaffen«.
Dass diese Tätigkeiten zur Linderung der massenhaften Not im Angesicht von großflächig zerstörten Produktionsstätten, dem Abtransport vieler intakt gebliebener Werke, fehlenden Rohmaterialien und Verkehrs- und Transportmöglichkeiten sowie einem fehlenden demokratischen Gemeinwesen stattfanden, macht zwei Dinge deutlich: Erstens, dass gewerkschaftliche Tätigkeit hier im umfassenden Ausnahmezustand stattfand, und zweitens, dass diese Tätigkeit und ihr Anspruch nicht an den Betriebsgrenzen endeten. Die gewerkschaftlich organisierten Betriebe und ihre Verbände übernahmen Aufgaben der Grundversorgung und des sozialen Gemeinwesens; das entsprach dem Anspruch vieler Gewerkschafter*innen, nach dem Faschismus nun stärkeren Einfluss auf die Gestaltung der Gesellschaft auch außerhalb der Werksgelände nehmen zu können. Politisches Ziel von vielen Aktiven war es, die Grundlagen für eine demokratische und sozialistische Gesellschaft zu legen. Für Arbeiterinnen wie Wally Vollmer (KPD) und Hedwig Franke (SPD), die im AEG-Werk in Treptow zur aktiven Belegschaft gehörten, bedeutete dies auch die Gleichberechtigung und die Lohngleichstellung der Frauen.
Das Schreiben des »Vorbereitenden Ausschusses« in der AEG und dessen Forderung nach »Arbeitsmöglichkeiten« verdeutlicht, dass neben der Entnazifizierung das zentrale Ziel der Gewerkschaftsinitiativen und spontan entstandenen Betriebsräte der Nachkriegszeit in der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen bestand. Auch nach 1945 galt: Ohne Arbeit kein Lohn und damit keine Mittel zum Leben – ohne Ort der Arbeit keine Arbeiter*innen, deren Interessen dort zu vertreten wären. Die Krux der Gewerkschaften bestimmte auch in der Nachkriegszeit von Beginn an ihr Handeln: die Interessenidentität mit den Kapitalist*innen, dass der Arbeitsplatz als Ort der Schaffung sowohl von Mehrarbeit als auch von Lohn zu erhalten ist.
In den überlieferten Quellen finden sich nur selten so deutlich antagonistische Äußerungen wie die der Bauarbeiter im Bezirk Prenzlauer Berg. Sie lehnten im August 1945 unbezahlte »freiwillige Mehrarbeit« für den Wiederaufbau der Stadt grundsätzlich ab, schließlich habe man den 8-Stunden-Tag unter großen Opfern erkämpfen müssen. Dagegen standen mehrheitlich sozialpartnerschaftliche Äußerungen und solche wie die des KPD-Politikers Hans Jendretzky auf einer Verbands- und Bezirkstagung des FDGB Groß-Berlin am 17. Juli 1945. Die »Deutsche Volkszeitung«, Organ der KPD in der SBZ (und Vorläufer des »Neuen Deutschland«), berichtete unter der zustimmenden Zwischenüberschrift »Wer nicht arbeitet, der soll nicht essen«, er habe ankündigt, »daß, wer arbeitsfähig ist und nicht zur Arbeit komme, auch keine Lebensmittelkarten mehr erhalte«. Selbständige Kampfansagen gegen den Ruf zur Lohnarbeit von sozialdemokratischen »Gewerkschaftsbonzen« wie von »SED-Hanswursten«, wie sie die Gruppe Arbeiterpolitik 1948 formulieren sollte, finden sich kaum in den überlieferten Unterlagen.
Die Quellen der gewerkschaftlichen Belegschaften im Berlin der zweiten Jahreshälfte 1945 stellen dagegen klar, dass Unternehmertum und kapitalistische Logiken weder im Nationalsozialismus abgebrochen waren noch vom Ausnahmezustand der unmittelbaren Nachkriegszeit suspendiert. Die Teilnehmer*innen der »Zusammenkunft aller A.E.G.-Betriebe« am 10. Juli 1945 in Treptow hielten fest: »Es besteht eine allgemeine Tendenz der Lohn- und Gehaltssenkung in den AEG-Betrieben.« Im August wurde dem vorläufigen Vorstand aus Kreuzberger Metallbetrieben gemeldet, es würden »verstärkt die Fragen des Lohnabbaus« auftreten. Dagegen setzten die Gewerkschafter*innen, ob aus sozialdemokratischer oder kommunistischer Tradition, auf die gesellschaftliche Kontrolle über die Produktion. Im bereits erwähnten Artikel über die FDGB-Tagung am 17. Juli wird der SPD-Politiker und spätere Bürgermeister Otto Suhr zitiert, angesichts der politischen und ökonomischen Lage sei »eine planmäßige Führung der Wirtschaft heute nötiger ... denn je«.
Neue Berliner Gewerkschaften
Die Kolleg*innen der AEG, die sich gegen die Demontagen ausgesprochen hatten, trafen sich als »Betriebsvertretung« bereits seit dem 10. Juni 1945 – dem Tag, an dem mit dem »Befehl Nr. 2« der SMAD, der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, die Gründung von Parteien und Gewerkschaften überraschend früh erlaubt worden war. Erst fünf Tage nach der Entstehung dieser »Betriebsvertretung« bei der AEG veröffentlichte der »Vorbereitende Gewerkschaftsausschuss für Groß-Berlin« seinen Gründungsaufruf, der sich in diesem Jahr zum 80. Mal jährt.
In der Selbstwahrnehmung der Funktionär*innen wie auch in der historischen Rückschau machen solche Schritte des Verbandsaufbaus »von oben« die entscheidenden Teile der Wiedergründung der Gewerkschaften aus. In der »Berliner Gewerkschaftsgeschichte von 1945 bis 1950«, die der DGB-Landesbezirk Berlin 1971 herausgab, kommen die Mitglieder nur als passive »Grundlage« einer jeden »Gewerkschaftsorganisation« vor, als aktive Mitbegründer*innen gar nicht. Dabei lief in den ersten Monaten parallel zum Apparataufbau die Gründung »von unten«. Aus dem grafischen Gewerbe in Kreuzberg wurde im August 1945 gemeldet: »In einem Teil der Betriebe sind Vertrauensleute gewählt worden. In den meisten dieser Fälle hatte die Belegschaft noch keine Verbindung mit der Gewerkschaft aufgenommen.« Der Metall-Verband aus Spandau hielt zum gleichen Zeitpunkt fest: »Das Mitbestimmungsrecht ist durch aktive Tätigkeit der Obleute in den meisten Betrieben zum Durchbruch gekommen.« (Der Begriff der Obleute, heute am ehesten bekannt mit dem Vorsatz »revolutionär« aus den Berliner Ereignissen der Novemberrevolution 1918, bezeichnete Vertrauensleute in den Betrieben.)
Im Aufruf zur Gründung von freien Gewerkschaften sprachen sich am 15. Juni 1945 acht Gewerkschaftsfunktionäre aus dem sozialdemokratischen, kommunistischen und christlich-konservativen Lager, darunter die oben genannten Schlimme, Chwalek und Kaiser, für die »Zusammenfassung aller früheren Richtungen« und eine »Kampfeinheit zur völligen Vernichtung des Faschismus und zur Schaffung eines neuen demokratischen Rechtes der Arbeiter und Angestellten« aus. Zu den politischen »Erstaufgaben«, die auf der Grundlage der Einheit der Arbeiter*innenbewegung angegangen werden sollten, gehörten der »Einsatz aller Arbeitskräfte« für Versorgung und Wiederaufbau, die »Vertretung der Arbeiter und Angestellten« durch Tarifverträge, die »Mitarbeit beim Wiederaufbau der Wirtschaft« und die »Erziehung der Arbeiterschaft im Geiste des Antifaschismus« und des »demokratischen Fortschritts«. Zwei Tage später, am 17. Juni 1945, kamen über 500 Gewerkschaftsfunktionär*innen im Neuen Stadthaus im Zentrum Berlins zusammen. Sie gründeten formal den FDGB Groß-Berlin, seine Bezirksausschüsse (20 Bezirke plus Post, Eisenbahn und Bewag) und 18 Industriegewerkschaften, von Bau und Eisenbahn bis zu Öffentlichen Betrieben und Kaufmännischen Angestellten. Die Wahl eines ordentlichen Vorstands war für den Herbst vorgesehen, erfolgte aber wegen Einsprüchen der alliierten Stadtregierung erst im Februar 1946.

Mit dem Jahr 1946 begann auch die dramatische Konfliktgeschichte des FDGB Groß-Berlin, die den Kalten Krieg auf der Ebene der Arbeiter*innenorganisationen nachvollzog. Zwei Jahre später endete sie mit der Gründung der sozialdemokratischen »Unabhängigen Gewerkschafts-Organisation« (UGO) in West-Berlin, einer Abspaltung vom SED-dominierten FDGB Groß-Berlin. Das zweite Halbjahr 1945 lag indes noch vor der Gründung der SED und vor den folgenden offenen Auseinandersetzungen innerhalb des FDGB. Die gewerkschaftliche Tätigkeit dieser Zeit war einerseits geprägt vom Handeln in der politischen Ausnahmesituation: Absprachen mit der alliierten Besatzung, Kritik der Demontagen, Verbesserung von Ernährungs- und Heizmittelversorgung, Produktion und Lohn, Mitbestimmung und Tarifverträge, nicht zuletzt die Frage der Kriegsschuld (»Die Arbeiter und Angestellten können sich nicht damit abfinden, die Schuldfrage auf sich zu nehmen«, notierte der Bezirk Kreuzberg im August 1945.) Andererseits wurden gewerkschaftsinterne Prozesse in Gang gesetzt, etwa die Frage, welche Einzelgewerkschaften für welche Branchen zuständig waren, und gegen Ende des Jahres auch die Vorbereitung einer stadtweiten Delegiertenkonferenz und von Betriebsrätewahlen.
Selbstbestimmung gegen die Reaktion
Die gewerkschaftlichen Bemühungen um die Versorgung der Bevölkerung, den industriellen und gesellschaftlichen Neuaufbau und die Entfernung von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern aus den Betrieben waren Teil einer grundlegenden Demokratisierungspolitik. Die Dimension dieser Leistung fehlt in vielen Darstellungen und veröffentlichten Erinnerungen zur Nachkriegszeit – dabei waren in Berlin, einer Stadt von etwa 3 Millionen Einwohner*innen, Ende 1945 immerhin 200 000 Menschen gewerkschaftlich organisiert, zwei Jahre später schon 700 000. Aus dieser parallel laufenden und zugleich verflochtenen Geschichte der Gewerkschaftsgründung sowohl von der Basis als auch von Funktionär*innen ist für heute weniger relevant, welche Ebene wichtiger war oder »die Nase vorn« hatte. Relevant ist vielmehr die Bedeutung von Selbstbewusstsein und Einflussmöglichkeiten am Arbeitsplatz für die Meinungsbildung von Arbeitenden – und damit für den Ausbau von demokratischen und solidarischen Räumen in der gesamten Gesellschaft. In einer Zeit, in der es um die Abwehr der Kombination von faschistischer Raumnahme und der Verschärfung kapitalistischer Ausbeutung geht, lohnt sich hier ein genauer Blick.
1945 hatten der Wiederaufbau von Betriebsräten und die Durchführung von Streiks gegen Nazis in den Betrieben antifaschistische und zivilisierende Wirkung, und beides legte zugleich die Grundlage für Organisationen der arbeitenden Klassen, deren Potenzial in den folgenden Jahren weder in BRD noch DDR eingelöst wurde. Aktuelle Studien wie »Kartographie der Arbeiter:innenklasse« (Friedrich-Ebert-Stiftung) und »Arbeitswelt und Demokratie in Ostdeutschland« (Otto-Brenner-Stiftung) zeigen, dass Erfahrungen der Solidarität noch 80 Jahre später ein »Bewusstsein für antagonistische Klasseninteressen« befördern, beziehungsweise dass das Erleben betrieblicher Wirksamkeit davor schützt, mit »regressiven Bearbeitungsformen« auf das »arbeitsweltliche Ohnmachtserleben« zu reagieren. Heute wie damals sind Selbstbestimmung und solidarische Praxis nicht nur eine Verteidigung »gegen rechts«, sondern gleichzeitig der erste Schritt auf einem möglichen Weg zu einer Verbesserung der Arbeitssituation und des Lebens insgesamt.
Henning Fischer ist Historiker und forscht zurzeit zur Geschichte der Berliner Gewerkschaften im Kalten Krieg.
Das »nd« bleibt. Dank Ihnen.
Die nd.Genossenschaft gehört unseren Leser*innen und Autor*innen. Mit der Genossenschaft garantieren wir die Unabhängigkeit unserer Redaktion und versuchen, allen unsere Texte zugänglich zu machen – auch wenn sie kein Geld haben, unsere Arbeit mitzufinanzieren.
Wir haben aus Überzeugung keine harte Paywall auf der Website. Das heißt aber auch, dass wir alle, die einen Beitrag leisten können, immer wieder darum bitten müssen, unseren Journalismus von links mitzufinanzieren. Das kostet Nerven, und zwar nicht nur unseren Leser*innen, auch unseren Autor*innen wird das ab und zu zu viel.
Dennoch: Nur zusammen können wir linke Standpunkte verteidigen!
Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:
→ Unabhängige und kritische Berichterstattung bieten.
→ Themen abdecken, die anderswo übersehen werden.
→ Eine Plattform für vielfältige und marginalisierte Stimmen schaffen.
→ Gegen Falschinformationen und Hassrede anschreiben.
→ Gesellschaftliche Debatten von links begleiten und vertiefen.
Seien Sie ein Teil der solidarischen Finanzierung und unterstützen Sie das »nd« mit einem Beitrag Ihrer Wahl. Gemeinsam können wir eine Medienlandschaft schaffen, die unabhängig, kritisch und zugänglich für alle ist.